Zwischen Sturm und Stabilität: Die Schweiz im geopolitischen Umbruch
Wer in den Weltkriegsjahren auf die Welt gekommen ist, blickt auf drei Epochen zurückt: Den Kalten Krieg, den demokratischen und wirtschaftlichen Aufbruch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und jetzt den brüsken Zerfall einer Weltordnung.
Während des Kalten Krieges lebte es sich auf der richtigen Seite des Eisernen Vorhangs gar nicht so schlecht. Die Bedrohung durch die kommunistische Seite disziplinierte den freien Westen, beide Seiten sorgten trotz aller Unterschiede mit dem atomaren Patt für eine gewisse Stabilität, und das grell sichtbare Versagen der staatlichen Planwirtschaft in den kommunistischen Diktaturen veranschaulichte klar die Überlegenheit von Demokratie, Freiheit, Freihandel und Marktwirtschaft.

Im Lichte dieser Erfahrung setzte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine eindrückliche Phase des Aufschwungs ein: Der Welthandel blühte, der globale Wohlstand nahm zu, extreme Armut und Hunger nahmen ab, die Lebenserwartung stieg, neue Demokratien entstanden. Für das Exportland Schweiz waren das fast paradiesische Verhältnisse.
Das alles geht nun brüsk zu Ende. Eine selbstbewusste autokratische Achse unter der Führung Russlands und Chinas verschreibt sich dezidiert dem Kampf gegen demokratisches Gedankengut. Sie lehnt eine Weltordnung mit souveränen demokratischen Staaten ab und strebt eine multipolare Ordnung mit einer Handvoll grosser Staaten an, die als Hegemonen ihr Vorfeld kontrollieren. Eine Zeitlang schien es, als könnte sich eine starke demokratische Achse unter der Führung der USA bilden – mit Ländern wie Australien, Japan, Südkorea, Kanada und mit der EU -, die der autokratischen Achse Paroli bieten könnte.
Schweiz muss sich an globale Entwicklungen anpassen
Die Wahl Trumps und sein zerstörerischer politischer Amoklauf machen diese optimistische Lösung fast tagtäglich unwahrscheinlicher. Er unterhöhlt nicht nur systematisch die demokratischen Institutionen seines eigenen Landes, sondern er führt die USA deutlich in Richtung hegemonialer Weltordnung. Eine zentrale Frage ist auch, ob sich das politisch zersplitterte und hoch verschuldete Europa trotz seiner wirtschaftlichen Stärke überhaupt als Machtfaktor zu behaupten vermag.
Ich gehe deshalb auf diese geopolitischen Entwicklungen ein, weil wir plötzlich brutal merken, wie sehr das Schicksal unseres Landes sehr direkt von stürmischen globalen Entwicklungen abhängt, die wir nicht beeinflussen können, aber an die wir uns anpassen müssen. Man könnte in Anlehnung an das berühmte Diktum von Obama sagen: «It’s geopolitics, stupid!»

Das Umfeld, in welchem die Schweiz bestehen muss, lässt sich in Stichworten zurzeit wie folgt zusammenfassen: Die erfolgreiche unipolare Weltordnung kollabiert, Macht löst mühsam erkämpftes Recht ab, und Kriege unweit von uns werden wieder geführt. Der regelbasierte Welthandel gerät ins Trudeln. Der Trump’sche Zollschock von 39 Prozent hat brutal gezeigt, was von der Affinität unserer «sister republic» zu unserem Land zu halten ist. Gleichzeitig setzt die demografische Alterung auch in der Schweiz die Sozialsysteme unter Druck. Die globale Verschuldung erreicht historische Ausmasse und gefährdet die Stabilität des globalen Finanzsystems. Die Demokratie verliert in vielen Demokratien an Zustimmung und gerät weltweit ins Wanken.
Hoffen auf eine Wende zum Guten
Zeiten zerfallender Weltordnungen sind immer gefährlich, und niemand kann die Zukunft voraussagen. Ein pessimistisches Szenario wäre die fortschreitende Entwicklung in Richtung der von den Autokraten angestrebten hegemonialen Weltordnung. Würde Europa durch innere Schwäche und Zersplitterung gar marginalisiert, wäre das Schrumpfen der Demokratie als Staatsform zur historischen Episode nicht mehr auszuschliessen.
Ein positives Szenario wäre die Rückkehr der USA zu einer global verantwortlichen Demokratie, die Entwicklung Europas zu einer militärisch und wirtschaftlich starken Macht sowie die Rückkehr zu einer regelbasierten Ordnung. Zurzeit sieht leider alles eher nach einem Trend zum pessimistischen Szenario aus. Aber es gibt immer auch überraschende Wenden zum Guten – etwa die Schaffung unserer Verfassung 1848, den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg oder die Überwindung der Konflikte in Europa durch die EU. Das gibt mir die Hoffnung, dass sich auch in der gegenwärtig verfahrenen Situation plötzlich Wege zum Besseren öffnen können.
Gerade die global erzielten Fortschritte nach dem Ende des Kalten Krieges sind der Beleg dafür, dass Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte, Welthandel und Marktwirtschaft funktionieren. Das Problem ist nicht die Demokratie an sich, sondern ihre Verletzlichkeit. Es ist deshalb den Schweiss der Edlen wert, sich mit aller Kraft für die Funktionsfähigkeit und die Selbstbehauptung der Demokratie einzusetzen. Und diese Aufgabe beginnt immer zuerst damit, das eigene demokratische Haus in Ordnung zu halten.
Neues Vertragspaket mit der EU erfüllt den Zweck
Im gegenwärtigen turbulenten Umfeld steht die Schweiz noch fast als eine Art Insel der Seligen da. Gemessen an fast allen Erfolgskriterien eines Staates befindet sie sich in einer Spitzengruppe. Das hat sie – neben glücklichen historischen Umständen – einer politischen Kultur zu verdanken, die auf geglückte Weise drei Prinzipien vereinigt: Freiheit, Genossenschaft und «Bottom Up». Diese drei Prinzipien bilden eine Art Trilemma, in welchem nicht alle gleichzeitig zu hundert Prozent erfüllbar sind und deshalb permanent ausbalanciert werden müssen.
Wegen des Bottom-up-Prinzips lehne ich einen Beitritt zur EU ab. Das politische Labor Schweiz ist sozusagen der strukturelle Gegenentwurf zur Top-down-Struktur der EU. Allerdings braucht Europa eine starke EU, um sich global zu behaupten und nicht vom einflussreichen Akteur zum Spielball der Grossmächte zu werden. Das ist auch im Interesse der Schweiz.
Aber die Schweiz hat auch als Nichtmitglied ein grosses Interesse daran, mit der EU ein vertraglich abgesichertes konstruktives Verhältnis einzugehen und den Zugang zum wichtigsten Absatzmarkt EU langfristig abzusichern. Die sogenannten Bilateralen III sind dafür eine taugliche Lösung. Das bedeutet auch keinen Souveränitätsverlust. Zur Souveränität eines Staates gehört es auch, mit kündbaren Verträgen Souveränität begrenzt einschränken zu können, wo es in seinem Interesse liegt. Das ist hier der Fall. Die Gegner der Bilateralen III diffamieren diese immer als versteckten ersten Schritt zum Beitritt. Für mich ist es gerade umgekehrt. Sie bieten eine gute Lösung dafür, unser Verhältnis zum grossen Nachbarn ohne Beitritt langfristig zu normalisieren.
Der noch gute Zustand der Schweiz scheint viele Miteidgenossen in der Illusion zu bewahren, Wohlstand und Stabilität seien gottgegeben. Aber es ist ein Irrglaube anzunehmen, ein derart global vernetztes Land bleibe unbeeinflusst von den aussen tobenden Stürmen. Ich glaube nicht, dass es Alterspessimismus ist, wenn ich der Meinung bin, die Schweiz sei seit dem Weltkrieg nie mehr mit einer derartigen Massierung von Problemen konfrontiert gewesen wie gerade jetzt. Dazu nur einige Stichworte:
Der global wachsende Protektionismus und die abwegige Wirtschaftspolitik der USA verschlechtern die Bedingungen für unsere Wirtschaft massiv. Die hoch verschuldeten Finanzmärkte erhöhen das Risiko einer erneuten Finanzkrise. Die Kriegsgefahr in Europa steigt, und die sogenannte hybride Kriegsführung trifft uns schon jetzt. Wegen der tiefen Geburtenrate würde der Schweiz ohne Zuwanderung eine Sechsmillionenschweiz drohen, dominiert von alten Leuten. Damit würde der Sozialstaat unfinanzierbar, und die Produktivität unserer Wirtschaft sänke drastisch. Zudem droht unsere Leistungsgesellschaft in eine Anspruchsgesellschaft zu mutieren, aber ohne Leistung sind Ansprüche unerfüllbar.
Gleichzeitig tat sich die Schweiz noch selten so schwer, schwierige Probleme mit tauglichen Kompromissen zu lösen. Deshalb hat sich in zentralen Bereichen ein gefährlicher Reformstau gebildet, etwa in der Sozial-, Sicherheits- oder Energiepolitik. Die Polparteien haben entdeckt, dass sich mit Polarisierungsstrategien und nicht mit konstruktiver Zusammenarbeit Wahlen gewinnen lassen. Statt dass man sich in schwierigen Zeiten zusammenschliesst, sucht man Sündenböcke und Schuldige. Wie peinlich ist doch zurzeit das innenpolitische Gezänk nach dem Scheitern der Verhandlungen mit Trump!
Der Reformstau muss aufgeflöst werden
Offensichtlich ist es einfacher geworden, mit Geschenken an die eigene Klientel oder einfachen Scheinlösungen zu punkten als mit der oft halt nötigen bitteren Medizin. Gleichzeitig hat man den Eindruck, die Forderungen an den Staat als Problemlöser seien vor allem seit Corona immer schamloser geworden. Politik ausschliesslich mit dem nassen Finger, mit unfinanzierten Gefälligkeiten und unter Vermeidung jeder Härte hat nirgends zu Erfolg geführt.
Neben der Sicherheitspolitik und der Auflösung des erwähnten Reformstaus stehen für mich Bemühungen im Vordergrund, unserer Wirtschaft im internationalen Gegenwind das Leben zu erleichtern. Nobelpreisträger Hayek hat schon vor Jahrzehnten geschrieben, das Einzige, was eine Demokratie gefährden könne, seien lange Perioden wirtschaftlicher Stagnation oder gar Rezession.
Man mag der Wirtschaft gegenüber skeptisch sein, aber es müsste ja allen klar sein, dass ohne eine profitable Hochleistungswirtschaft alle Segnungen, die vom Staat erwartet werden, eine Illusion sind, angefangen beim Sozialstaat über Bildung und Forschung bis zur Landesverteidigung. Und was eine schwächelnde Wirtschaft vor allem für die Schwächsten in der Gesellschaft bedeutet, sehen wir täglich am Fernsehen.

Ich habe darauf hingewiesen, wie verletzlich Demokratien sind. René Rhinow war schon immer ein empfindlicher Sensor, der solche Verletzlichkeiten zu deuten vermag. Er verfügt über die Gabe, im flüchtigen Zeitgeist das langfristig Zentrale aufzuspüren. Die Spannweite der Probleme, die er kompetent beleuchtet, reicht von der Aussenpolitik, der Neutralität und der Sicherheitspolitik über den Rechtsstaat, das Völkerrecht, den Populismus und die Polarisierung bis zu tiefgründigen Gedanken über Heimat, Identität, Bürgerlichkeit und Souveränität.
Das Buch ist eine Fundgrube für politisch Interessierte, die nach differenzierter Analyse und nach Wegweisern suchen. Es ist getragen vom freiheitlichen Geist eines auch der Gemeinschaft verpflichteten Liberalismus. Und es ist von brennender Aktualität.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben

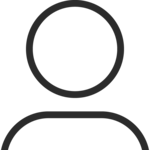








Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.