Investitionen und Digitalisierung: Mittel zum Zweck

Für die Vorbereitung meiner ersten Aufsichtsratssitzung erhielt ich von der FMA einen Stapel Papier zugestellt. Das ist Vergangenheit. Heute arbeiten wir mit einer speziellen Management-Software vollständig digital. Das Tablet mit Stift hat das Papier abgelöst. Das ist effizient, sicher und praktisch. Digitalisierung pur.
Die Finanzmarktaufsicht arbeitet schon stark digital. Und doch sind wir erst mitten in einer digitalen Transformation, deren Endpunkt nicht absehbar ist. Sie fordert uns auf drei Ebenen. Erstens verändern sich die Finanzmärkte, die Finanzdienstleister und ihre Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung tiefgreifend. Die FMA überwacht damit einen zunehmend digitalen Finanzsektor. Zweitens verlagert sich der Austausch der FMA mit ihren Anspruchsgruppen wie Marktakteure oder Partnerbehörden zunehmend auf digitale Kanäle. Und drittens digitalisieren wir laufend interne Geschäftsprozesse. Diese Transformation erfordert grosse Investitionen. Wir haben in den letzten Jahren grössere Beträge in eine moderne IT-Umgebung, ein CRM, ein DMS, ein e-Service-Portal, in Analysetools sowie in moderne Arbeitsmittel investiert. Zusätzlich auch in Personalressourcen und in digitales Know-how.
Mehrwert schaffen
Diese Investitionen dienen keinem Selbstzweck, sondern sind Mittel zum Zweck. Mit jedem Franken, den wir in die Digitalisierung investieren, wollen wir für die Finanzintermediäre, den Finanzplatz und das Land einen Mehrwert schaffen.
Das erreichen wir beispielsweise dadurch, dass wir mit digitalen Dienstleistungen den Finanzintermediären ihr Geschäft erleichtern. Die Interaktionen mit der FMA sollen über digitale Kanäle ohne Medienbrüche effizient, sicher und mit einem möglichst geringen Ressourceneinsatz ausgeführt werden können. So werden Bewilligungsprozesse zunehmend digitalisiert und für die Antragsteller bequemer und schneller. Das ist ein Vorteil im internationalen Standortwettbewerb. Im Meldewesen stellt die FMA den Finanzintermediären ein e-Service-Portal zur Verfügung. Mit der Regulierungsflut im Finanzsektor sind die Reportingpflichten an die FMA viel umfangreicher und komplexer geworden.
Mehrwert schaffen wir auch, indem wir mit dem Einsatz von modernen Informationstechnologien auch in der digitalen Ära eine wirksame und effiziente Aufsicht sicherstellen. Ein digital funktionierender Finanzsektor verlangt auch digitale Antworten seitens der Aufsichtsbehörden. Supervisory Technology ist hier das Zauberwort. Realität ist, dass die Datenmengen und die Komplexität der Daten, die der FMA gemeldet werden und die sie auswerten muss, massiv zugenommen haben.
Alleine in der Transaktionsdatenüberwachung bei Geschäften mit Finanzinstrumenten im Rahmen von MiFID II und MiFIR sind bei der FMA in einem Jahr Daten zu sechs Millionen Transaktionen eingegangen. Ein Analysetool sondert verdächtige Transaktionen aus. Diese werden dann von unseren Spezialisten unter die Lupe genommen. Sie sollen das tun, was die Informationstechnologien nicht oder noch nicht können.
Die FMA kann auf einer weiteren Ebene Mehrwert schaffen. Die Digitalisierung ist eine Chance für unseren Finanzplatz. Mit Kompetenz, Zugänglichkeit und Schnelligkeit wollen wir dazu beitragen, dass Liechtenstein als innovationsfreundlicher und attraktiver Standort wahrgenommen wird. Wir haben mit der Gruppe Regulierungslabor/Finanzinnovation ein motiviertes Team als Anlaufstelle für Fintechs und etablierte Finanzdienstleister im Einsatz.
Die Digitalisierung erlaubt uns auch, die Attraktivität der FMA als Arbeitgeberin zu steigern. Wir wollen unseren Mitarbeitenden eine moderne Arbeitsumgebung und konkurrenzfähige Anstellungsbedingungen bieten können. Denn auch in der digitalen Zeit sind die Menschen, die für die FMA und den Finanzplatz arbeiten, die wertvollste Ressource.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
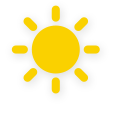





Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.