Der Tod: Ein Tabuthema
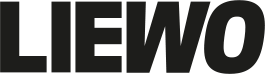
Der Tod ist das Ende, das jeden Menschen erwartet. Trotzdem hat er sich in unserer Gesellschaft irgendwie zu einem Thema entwickelt, über das kaum oder nur ungern gesprochen wird. Der Tod wird von vielen Menschen bewusst verdrängt, oft weil man Angst vor dem Sterben oder vom Verlust der Menschen, die einem nahestehen, hat. Vor allem in jungen Jahren möchte man sich nicht mit dem Tod oder den Themen, die damit zusammenhängen, auseinandersetzen. Man will den Tod nicht wahrhaben, verdrängt ihn und schiebt das Thema auf.
Tod im gesellschaftlichen Wandel
Die Ursachen für die Tabuisierung des Todes sind vielfältig. Historisch gesehen war der Tod in vielen Kulturen sehr lange Teil des alltäglichen Lebens und wurde mit unterschiedlichen Ritualen verbunden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts starben die Leute in der Regel zu Hause im Kreis der Familie. Der Tod war somit ständig präsent in der Gegenwart der Lebenden. Man nahm gemeinsam Abschied und trauerte auch gemeinsam.
Mit dem Aufkommen der modernen Medizin und Krankenhäuser wurde der Tod jedoch aus dem familiären Rahmen in ein quasi anonymes Feld ausgelagert. Viele traditionelle Abschiedsrituale sind damit ebenfalls verloren gegangen oder werden heute als veraltet und unzeitgemäss empfunden. Der Tod findet heutzutage meistens hinter verschlossenen Türen statt – in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Angehörige erfahren ihn damit oft nur indirekt. Viele Menschen haben daher auch keine Vorstellung mehr davon, wie Sterben wirklich aussieht. Die Ärzte versuchen ebenfalls das Leben so gut es geht zu verlängern und den Tod zu vermeiden. Wenn er dann doch eintritt, wird er häufig als ein Misserfolg der Medizin angesehen und nicht als natürlicher Teil des Lebens. Somit hat sich eine gewisse Distanz zwischen den Menschen und dem Tod entwickelt.
Der heute vorherrschende Jugendwahn und eine Gesellschaft, die auf Erfolg und Leistung ausgerichtet ist, tragen ebenfalls dazu bei, das alles, was mit Alter oder Schwäche zu tun hat, häufig aus dem Alltag verdrängt wird. Irgendwann wird jedoch jeder Mensch mit dem Tod konfrontiert, sei es der eigene oder der von geliebten Menschen.
Je älter man wird, umso bewusster wird einem auch die eigene Vergänglichkeit. Viele fangen erst dann an, sich Gedanken über Patientenverfügungen, Testamente, Sterbehilfe oder die eigene Bestattung zu machen. Manche sprechen den eigenen Tod eventuell auch im Familien- oder Freundeskreis an, häufig schwingt dabei aber dennoch eine gewisse Unsicherheit mit, da man ein Thema auf den Tisch bringt, das viele als unangenehm betrachten.
Ein offener Austausch ist aber wichtig und sollte gefördert werden. Über den Tod zu sprechen, hilft, ihm seinen Schrecken zu nehmen. Studien zeigen, dass Menschen, die offen über den Tod sprechen, oft weniger Angst und Stress empfinden. Wenn der Tod kein Tabu mehr ist, wird auch Trauer leichter. Man kann über den Verlust sprechen, ohne das Gefühl zu haben, andere damit zu belasten.
Darüber hinaus ermöglicht die offene Kommunikation wichtige Vorkehrungen zu treffen. Wer seine Wünsche rechtzeitig klärt – etwa bezüglich lebensverlängernder Massnahmen oder wie man bestattet werden möchte –, entlastet nicht nur die Angehörigen, in einer emotionalen Ausnahmesituation wichtige Entscheidungen treffen zu müssen, sondern bestimmt auch sein Lebensende.
Weitere Beiträge zum Liewo-Thema:
Rechtsanwältin Oehri: «Sinnvoll ist ein Testament, sobald man Vermögen besitzt»
Jeeves: «Ein Buch, das bleibt – auch wenn man selbst geht»
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
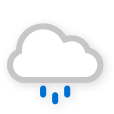

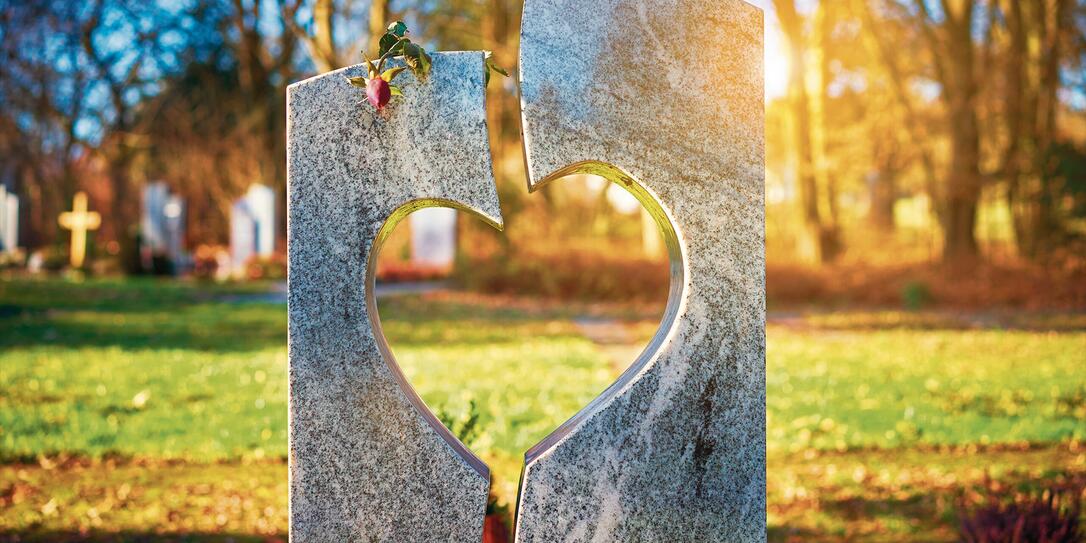




Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.