Eine Angst, der man sich stellen kann

Höhenangst ist eine der häufigsten Phobien überhaupt: Es wird davon ausgegangen, dass rund 20 Prozent der Menschen davon betroffen sind. Allerdings handelt es sich dabei um Schätzungen. «Interessanterweise habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Psychologin noch nicht eine einzige Anmeldung nur aufgrund von Höhenangst erhalten, obwohl wir es als Psychotherapeutinnen sehr oft mit Ängsten zu tun haben», erklärt Psychotherapeutin Priska Senti. Der Grund dafür liege unter anderem darin, dass sich höhenexponierte Situationen gut umgehen liessen, ohne dass daraus subjektiv grosse Nachteile entstünden, führt die Fachpsychologin für Psychotherapie weiter aus.
Es ist auf jeden Fall hilfreich, sich ausreichend Zeit zu nehmen, sich nur auf den nächsten Schritt zu konzentrieren und dabei nicht in die Tiefe oder Weite zu blicken.
Eine Behandlung ist möglich, aber nicht immer nötig
Klar, Respekt vor grossen Höhen – oder grossen Tiefen – haben die meisten Menschen. Charakteristisch für Höhenangst, oder auch Akrophobie, ist eine übermässige und nicht durch reale Gefahr erklärbare Angst vor Höhen. «Sie führt zu unangenehmen körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Atemnot, Zittern, Schwitzen und Übelkeit in unterschiedlichen Stärkegraden» – und macht eigentlich durchaus Sinn. Grundsätzlich ist die Angst ein evolutionsbiologischer Schutz vor Gefahr. «Wenn Höhenangst aber mit anderen Ängsten gekoppelt ist oder sich weiter ausbreitet – sich beispielsweise schon beim Treppensteigen bemerkbar macht –, dann ist eine Behandlung notwendig.» Wie diese abläuft, ist verschieden, da es unterschiedliche therapeutische Herangehensweisen gibt. «Oft stellt man beispielsweise eine Angsthierarchie auf. Dabei werden angstauslösende Situationen nach dem Grad ihrer Schwierigkeit sortiert. Darauf folgt die Konfrontation in ansteigender Schwierigkeit.» Der Habituationseffekt spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Wer sich immer wieder in Situationen begibt, in denen die Angst aufkommt, kann seinen Körper langsam daran gewöhnen und die Ängste vermindern.
Die Angst kann «vererbt» werden
Die Ursachen für Höhenangst können unterschiedlich sein. Sie kann durch ein vorgelebtes Verhalten übernommen werden, durch ein vorausgehendes Erlebnis, beispielsweise ein Beinahe-Sturz, oder sich auch durch sogenannten Höhenschwindel entwickeln. «Schwindel in der Höhe entsteht, wenn sich die Augen zu wenig ‹festhalten› und orientieren können. Daraus kann unter Umständen Höhenangst entstehen», führt die Psychologin aus. Sie kann sich auch aufgrund anderer Faktoren wie Stress entwickeln. Die Ursachen sind vielfältig, eine Behandlung ist zum Glück recht gut möglich.
Vorsicht ist in den Bergen unabdingbar
Wer mit Höhenangst in die Berge geht und sich seiner Angst stellen möchte, sollte sich Zeit nehmen und nicht überhastet oder eilig schwierige Stellen passieren. Denn durch die Angst kann die Trittsicherheit vermindert sein. «Es ist auf jeden Fall hilfreicher, sich ausreichend Zeit zu nehmen, sich nur auf den nächsten Schritt zu konzentrieren und dabei nicht in die Tiefe oder Weite zu blicken», erklärt Senti. Die Atmung kann dabei eine entscheidende Rolle spielen – tiefes Ein- und Ausatmen kann beruhigen und die Angst mindern. «Zudem gibt es verschiedene Entspannungstechniken, die wir mit den Patienten gemeinsam erarbeiten können», so die Psychologin. «In den meisten Fällen lässt sich eine isolierte Höhenangst in relativ kurzer Zeit behandeln», und dann steht dem nächsten Ausflug in die Berge nichts mehr im Weg.
Tipps gegen Höhenangst:
- sich seiner Angst bewusst sein
- überlegen, in welchen Situationen die Angst auftritt
- gezielt Situationen suchen, in denen die Angst aufkommt, und sich der Angst stellen (nicht ablenken)
- die Angst aushalten und warten, bis sie nachlässt, bevor man den nächsten Schritt macht
- erst «einfache» Hürden meistern und sich langsam steigern
Schlagwörter
-
Priska Senti
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
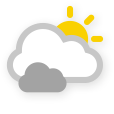







Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.