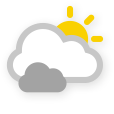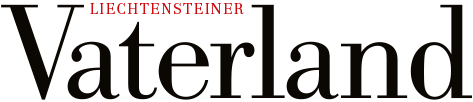Anleitung zum Bundesratsein: Walter Thurnherr erklärt, wie Regieren geht – und lästert loyal
Die Erwartungen an das Buch von Walter Thurnherr sind hoch. Als Bundeskanzler (2016 bis 2023) galt er als exzellenter Redner. Ob Maturfeier, 1. August oder Wirtschaftskongress: Seine geistreichen, humorvollen Ansprachen wurden begeistert aufgenommen.
Gemessen daran wirkt das Buch auffallend ernsthaft – auch wenn der Titel mit dem Wörtchen «trotzdem» Thurnherrs Schalk anklingen lässt: «Wie der Bundesrat die Schweiz regiert – und weshalb es trotzdem funktioniert».
Nur 15 Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler gab es seit 1848, Thurnherr war Nummer 14. Je länger er im Amt war, desto häufiger fragte man sich, ob er sich nicht als künftigen Bundesrat sah. Nach dem Rücktritt seiner CVP-Parteikollegin Doris Leuthard (2018) wies er solche Spekulationen zurück.
Er hätt’s gekonnt
Das Buch lässt dieses Dementi in neuem Licht erscheinen. Thurnherr erklärt, was einen guten Bundesrat auszeichnet, wie er sich im Kollegium und gegen aussen verhalten sollte und worauf es im Krisenmanagement ankommt. Den Leser beschleicht unvermeidlich das Gefühl: Schreibt da einer über sich selbst?
Es könnte sein, dass ihn die Erkenntnis, er wäre ein guter Bundesrat gewesen, erst nach seinem Rücktritt ereilt hat. Sie muss nicht einmal das Motiv für sein Buch gewesen sein; vielleicht war sie bloss eine Folge seiner Entstehung.
Die Idee zum Buch entstand aus seiner ETH-Vorlesung über die Entfremdung zwischen Wissenschaft und Politik – und wie sie sich überwinden lässt. Den Duktus des Dozenten legt Thurnherr auch als Autor nicht gänzlich ab. Schreibt er über das Regieren in Zeiten der Krise, bemängelt er, dass Mitglieder des Bundesrats das Kollegium oft zu spät oder unvollständig informieren – und sagt, wie man es besser machen müsste. Als Beispiele nennt er Corona und auch die Credit-Suisse-Krise im Herbst 2022.

Thurnherr vermeidet es, Ross und Reiter beim Namen zu nennen. Wer in der CS-Krise zu wenig informiert hat, war Finanzminister Ueli Maurer. Das weiss das Land spätestens seit dem PUK-Bericht. Thurnherr lässt den Namen weg.
Diese diplomatische Art zieht sich durchs Buch. Animositäten im Bundesrat deutet Thurnherr an: «Ab und zu gibt es Persönlichkeiten, die sich über längere Zeit aus dem Weg gehen.» Beispiele? Fehlanzeige.
Das gilt auch für seine Beobachtung, «erstaunlich vielen» Bundesräten steige das Präsidialjahr zu Kopf. Thurnherr sah hier eine «eigentümliche Transformation»: «Während das Mitglied des Bundesrates zu Beginn seiner Präsidentschaft die neue Rolle sehr zurückhaltend angeht und sich über all die kleinen protokollarischen Vorzüge und Sonderbehandlungen wundert, werden Letztere nach spätestens zehn Monaten zu einer Selbstverständlichkeit, dann zu einer Erwartung und schliesslich zu einem Anspruch.»
Seltener Seitenhieb – gegen Ignazio Cassis
Es sind wohldosierte, loyale Lästereien. Thurnherr weiss: Die gierigsten Leser seines Buches dürften diejenigen Magistraten sein, mit denen er gemeinsam im Bundesratszimmer sass. Denn der Bundeskanzler ist an jeder Sitzung dabei. Er könnte jede Episode, jeden Mitbericht, jedes Fettnäpfchen datieren und zuordnen.
Dass er das nicht tut, ist sympathisch, hilft aber nicht, das Buch zu einem Pageturner zu machen. Was wiederum zu Thurnherrs Medienverständnis passt. Dieses könnte man als «old school» bezeichnen. Die Personalisierung der Politik in den sozialen Medien ist Thurnherr ein Gräuel, lieber sind ihm «mehrspaltige Analysen» zu bundesrätlichen Entscheiden in gedruckten Zeitungen, wie sie früher üblich waren.

Doch auch Loyalist Thurnherr ist nur ein Mensch, und so stösst man auf zwei Spötteleien, die unverblümt einen Bundesrat adressieren. Es ist beide Male derselbe: Ignazio Cassis. Das eine Mal erwähnt er, wie Cassis während Corona mit zwei Beatmungsgeräten ins Tessin gereist sei.
Beim anderen Mal stellt er Cassis’ Reaktion auf Russlands Angriffskrieg jener von Olaf Scholz gegenüber: «Wir haben Krieg in Europa», habe Scholz in Berlin gesagt, während Cassis in Bern erklärt habe: «Auf europäischem Boden hat ein bewaffneter Konflikt begonnen.» Thurnherr kommentiert trocken: Das sei «nicht ganz dasselbe». Auf der Thurnherrschen Richterskala von 0 bis 10 steht diese Kritik bei etwa 9,5.
Sie hat viel damit zu tun, dass für Thurnherr die Sprache ein zentrales Instrument der Politik ist. In der Schweiz sei Reden aber bloss eine Pflichtübung, stellt er mit Bedauern fest. Während in Grossbritannien, Deutschland oder Frankreich eine Rede nur dann wirke, wenn sie rhetorisch stark sei, gelte Eloquenz hierzulande als verdächtig und elitär. Deshalb würden manche Bundesräte bei öffentlichen Auftritten bewusst «Kratzlaute und Ähs» einbauen, um bodenständig zu wirken.
Wer nichts zu sagen habe, solle auch nichts sagen, urteilt Thurnherr. Ein guter Redner müsse ein eingängiges Bild benutzen und überzeugende Beispiele finden. Wie wahr. Es ist zu hoffen, dass sich die amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräte diese Passage dick anstreichen.
Die zehn Voraussetzungen für einen guten Bundesrat gemäss Thurnherr
1 Das Amt muss einem gefallen!
2 Man muss eine gute physische Konstitution haben.
3 Eine Bundesrätin oder ein Bundesrat muss entscheiden können.
4 Eine Bundesrätin respektive ein Bundesrat muss gerne, gut und mit allen kommunizieren.
5 Jedes Mitglied des Bundesrates muss das politische System der Schweiz kennen und den Ehrgeiz haben, auf bestimmten Fachgebieten seiner Zuständigkeit eine Expertin oder ein Experte zu werden.
6 Eine Bundesrätin oder ein Bundesrat muss eine Verwaltung führen können.
7 Eine Bundesrätin respektive ein Bundesrat muss etwas verändern wollen.
8 Eine Bundesrätin, ein Bundesrat muss kollegial sein.
9 Eine Bundesrätin, ein Bundesrat muss belastbar sein und ungerechtfertigte Kritik aushalten.
10 Eine Bundesrätin, ein Bundesrat muss ein Gespür für das richtige Timing haben.
Angst vor der Lektüre müssen sie keine haben; ein Enthüllungsbuch ist das 400-Seiten-Werk mitnichten, eher eine Anleitung zum Bundesratsein – und darüber hinaus eine staatsbürgerliche Aufklärung über das politische Betriebssystem der Schweiz. Verständlich, präzise und mit unverkennbarer Be- und Verwunderung darüber, dass dieses recht gute Ergebnisse produziert.
Die Gefahr des Vergessenwerdens
Es liest sich als Verteidigungsschrift für das helvetische System; grosse Reformen werden weder für die Verwaltung noch für den Bundesrat und den Föderalismus angeregt.

Natürlich schreibt Thurnherr auch über das Amt des Bundeskanzlers. Die ideale Besetzung sei eine «starke, unabhängige und umsichtige Persönlichkeit, die die Verwaltung kennt, die Politik versteht, im Hintergrund wirkt – und arbeitet wie ein Ochse». Eine solche Figur sei Karl Huber gewesen, Bundeskanzler in den 1970er-Jahren. Er sei leider in Vergessenheit geraten.
Thurnherrs Buch trägt dazu bei, dass ihm dieses Schicksal nicht widerfahren wird.
Walter Thurnherr: Wie der Bundesrat die Schweiz regiert, und weshalb es trotzdem funktioniert. Kein&Aber 2025 (ab 27. Oktober). 400 Seiten, ca. 42 Franken.

Copyright © 2025 by Vaduzer Medienhaus
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.