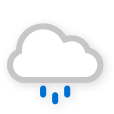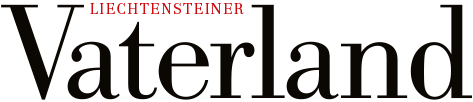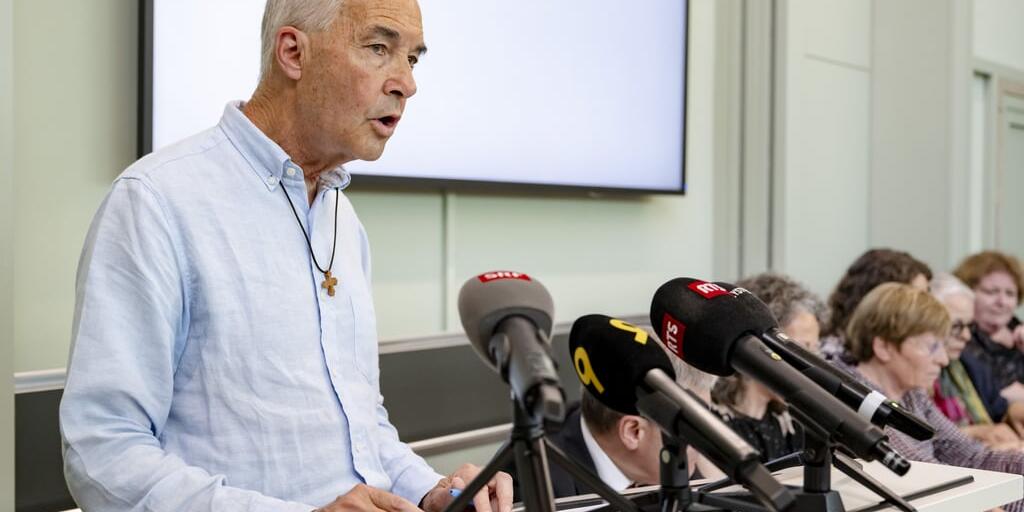Rassistische Whatsapp-Nachrichten: Vier weitere Lausanner Polizisten suspendiert ++ Toter Jugendlicher in Lausanne: Polizei hielt Marvin für einen Räuber
17:00
Montag, 1. September
Weitere Polizisten wegen rassistischen Whatsapp-Nachrichten suspendiert
Wie die Stadt Lausanne am Montag mitteilte, haben der Sicherheitsvorsteher Pierre-Antoine Hildbrand (FDP) und Polizeikommandant Olivier Botteron vier weitere Angehörige der Stadtpolizei per sofort vom Dienst suspendiert. Die vier betroffenen Beamten sollen in zwei Whatsapp-Gruppen unangemessene Bilder und Nachrichten geteilt haben. Den Whatsapp-Gruppen gehörten zumindest zeitweise mehrere Dutzend aktive Polizeibeamte an - was rund 10 Prozent der Angehörigen des städtischen Polizeikorps entspricht.

Am Montag vor einer Woche informierten die Lausanner Behörden an einer Pressekonferenz über eine detaillierte Auswertung der Chatgruppen im Rahmen einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte rassistische, sexistische, antisemitische, islamfeindliche und weitere diskriminierende Botschaften ans Tageslicht befördert. Bereits damals wurde die sofortige Suspendierung von vier Beamten kommuniziert.
Mit den nun erfolgten Suspendierungen sei die Auswertung des Materials der Staatsanwaltschaft durch die Stadt Lausanne abgeschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand werde es keine weiteren Freistellungen geben. Alle Polizeibeamten, die die problematischen Bilder verschickt hatten und noch im Dienst der Stadt Lausanne stehen, seien nun suspendiert.
In der gleichen Medienmitteilung kündigte die Stadt Lausanne an, mithilfe einer Anwaltskanzlei eine anonyme Anlaufstelle zu schaffen, an die sich Polizeibeamte vertraulich wenden könnten.
Die Enthüllungen über Rassismus in Polizei-Chatgruppen fielen zeitlich zusammen mit dem Unmut über den Tod des 17-jährigen Marvin. An zwei aufeinanderfolgenden Nächten kam es im Quartier Le Prélaz zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen.
Der dunkelhäutige Marvin war mit einem mutmasslich gestohlenen Roller in der Nacht auf den vorletzten Sonntag auf der Flucht vor einer Polizeipatrouille tödlich verunfallt. Es war der zweite ähnliche Fall innert weniger Monate. Ende Juni war eine 14-Jährige ohne Helm und ohne Ausweis auf einem mutmasslichen geliehenen Scooter vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei stürzte sie und erlag im Spital ihren Verletzungen. (cbe)
12:47 Uhr
Freitag, 29. August
Polizei hielt Marvin für einen Räuber

Am Samstag findet in Lausanne ein Trauermarsch für Marvin statt. Der 17-jährige Schweizer mit kongolesischen Wurzeln verunglückte am letzten Sonntagmorgen tödlich. Er flüchtete mit einem Scooter vor der Polizei und prallte in eine Mauer. Der Vorfall führte zu zwei Krawallnächten hintereinander. Vorwürfe aufgebrachter Jugendlicher lauteten: Es ist unverhältnismässig, wegen eines gestohlenen Rollers einen Teenager in die Enge zu treiben, und die Polizei ging auf Marvin los, weil er schwarz ist. Marvins Familie und Freunde distanzierten sich von den Randalierern.
Jetzt werden neue Details zum Ablauf des Dramas bekannt. Sie legen nahe, dass die Vorwürfe der Krawallanten nicht zutreffen, sondern der Unfall eher als Folge einer Verkettung unglücklicher Zufälle passierte. Oder anders gesagt: Marvin befand sich zum falscher Zeit am falschen Ort.
Eine Patrouille der Stadtpolizei Lausanne rückte um 3:45 Uhr wegen eines Raubs aus. Drei Unbekannte überfielen zwei Männer und verletzten einen von ihnen mit einem Messer, wie ein Sprecher der Waadtländer Staatsanwaltschaft auf Anfrage von CH Media sagt. Das Delikt passierte unmittelbar in der Nähe des Quartiers, in der sich zu dieser Zeit Marvin mit einem gestohlenen Scooter aufhielt. Er trug einen Helm.
Als die Polizei wegen es Raubs im Quartier ankam, sah sie, wie ein ihr entgegenkommender Scooterfahrer in hohem Tempo davonraste. Angesichts des Fluchtversuchs verdächtigten ihn die Polizisten, er könnte in den Raub verwickelt sein, und verfolgten ihn. Dann passierte der tragische Unfall, bei dem Marvin das Leben verlor. Dass der Scooter gestohlen war, wussten die Polizisten nicht. Die Staatsanwaltschaft stellt klar: Es gibt keinerlei Hinweise, dass Marvin etwas mit dem Raub zu tun hat. Dazu läuft eine separate Strafuntersuchung. (kä)
12:31 Uhr
Donnerstag
Ukrainische Premierministerin zu Besuch in der Schweiz
Hoher Besuch aus der Ukraine: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Donnerstag die ukrainische Premierministerin Julija Swyrydenko in Bern empfangen. Im Zentrum des Gesprächs sei der Friedensprozess und der Wiederaufbau der Ukraine gestanden, teilte Keller-Sutters Departement mit. Die Bundespräsidentin habe die Bereitschaft der Schweiz unterstrichen, ihre Guten Dienste im Friedensprozess zu leisten.
Beim Wiederaufbau arbeitet der Bund dabei mit dem Privatsektor zusammen. Anlässlich des Besuchs hat der Bund bekannt gegeben, welche Unternehmen mit welchen Plänen konkret unterstützt werden. Es handelt sich um zwölf Projekte Bereichen Infrastruktur (Energie, Wohnen), öffentlicher Transport, Gesundheit und humanitäre Minenräumung.
Der Bund unterstützt die Unternehmen mit insgesamt 93 Millionen Franken. 19 Millionen Franken steuern die Firmen selbst bei oder ukrainische Partner. Rund 60 Unternehmen hätten Projektvorschläge eingereicht, aus denen der Bund dann gemeinsam mit der Ukraine ein Dutzend auswählte.
Mit 15 Millionen am meisten Bundesgelder erhält die Firma Divario aus Herisau für den Bau von Fertighäusern für Binnenvertriebene. Über 50 Arbeitsplätze sollen in der Ukraine geschaffen werden. Auch Geberit, Glas Trösch oder beispielsweise Roche erhalten Bundesgelder für Wiederaufbau-Projekte in der Ukraine. Der Pharmakonzern Roche will in einem ukrainischen Spital ein medizinisches Labor eröffnen und Personal ausbilden. (lha)
09:33 Uhr
Donnerstag, 28. August
Blatten: Klöppel der Kirchenglocke aufgetaucht
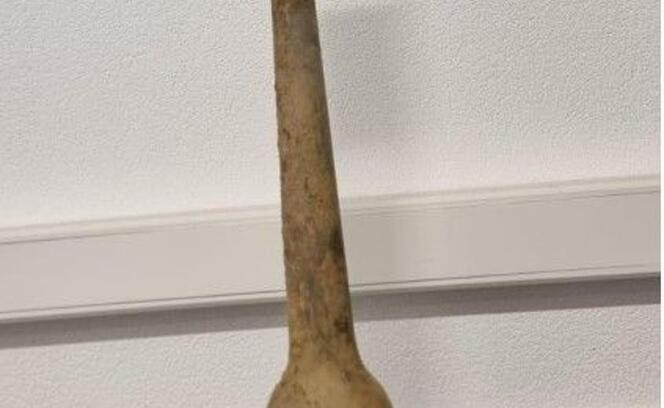
In Walliser Dorf Blatten dauern die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Bergsturz vom 28. Mai weiterhin an. Nun kam ein besonderer Gegenstand zu Tage. Mutmasslich handelt es sich um den Klöppel einer Kirchenglocke der Kirche Blatten, wie die Gemeinde schreibt.
Das bedeute wohl auch gleichzeitig nichts Gutes für den Zustand des Gotteshauses generell. «Aufgrund des Fundortes müssen wir von einer erheblichen Zerstörung der Kirche ausgehen», heisst es in der Mitteilung an die Bevölkerung. Der Klöppel wurde mehrere hundert Meter vom Standort der Kirche gefunden. (mg)
16:43 Uhr
Dienstag, 26. August
Ex-Frau und Kinder getötet: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mord
Am Dienstag vor einer Woche traf die Polizei in einer Wohnung im Neuenburger Stadtteil Corcelles auf ein Bild des Schreckens. Als sie die Türe mit Hilfe eines Schlossers öffneten, entdeckten zwei Ordnungshüter die Leichen zweier Mädchen im Alter von dreieinhalb und 10 Jahren. Die Polizisten stoppten einen Mann mit Schüssen in die Beine, der mit einem Messer in der Hand auf sie losstürmte. In einem anderen Zimmer fanden sie die tote Ehefrau.
Wie die Staatsanwaltschaft eine Woche nach dem Femizid und der doppelten Kindstötung mitteilte, führt sie nun ein Verfahren wegen Mordes gegen den Mann. Bei einem Mord handelt der Täter besonders skrupellos und verwerflich. Der Algerier brachte seine seit kurzem getrennt von ihm lebende Frau und seine Kinder mit einem Messer um.
Bei einer ersten Befragung gestand er die Tat von «unbeschreiblicher Grausamkeit», wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Weshalb er die Tat verübt habe, habe er aber nicht erklären können. Er gab auch zu, absichtlich mit einem Messer auf einen Polizisten losgerannt zu sein.
Die Polizei wurde am Tag der Dreifachtötung um 21 Uhr von einer Familienangehörigen der Opfer darüber informiert, dass sie sich Sorgen mache. Eine rechtsmedizinische Untersuchung hat jetzt offenbart, dass die Frau und die beiden Mädchen spätestens schon um 17:30 verstorben waren. Die Polizeibeamten rückten nach dem Anruf zur Wohnung aus und entschieden sich, die Tür gewaltsam zu öffnen. (kä)
14:54 Uhr
Montag, 25. August
Jurassischer Regierungsrat Martial Courtet kandidiert als Unabhängiger
Martial Courtet kandidiert bei den kantonalen Wahlen am 19. Oktober als unabhängiger Kandidat für den jurassischen Regierungsrat. Der 49-jährige Courtet gehört der Regierung seit 2015 als Vertreter der Mitte (zuvor: CVP) an und ist der amtsälteste Bildungsdirektor der Westschweiz.
Letzte Woche war Courtet vom Vorstand der Mitte des Kantons Jura dazu aufgefordert worden, sich von der Wahlliste zurückzuziehen. Der Grund sind die Ergebnisse eines am vergangenen Mittwochs veröffentlichten externen Untersuchungsberichts, den die Kantonsregierung in Auftrag gegeben hatte.
Der Bericht kritisiert Courtets autoritären Führungsstil und stellt fest, dass unter seiner Leitung im Departement für Bildung, Kultur und Sport ein Klima der «weit verbreiteten Angst und des Misstrauens» vorherrsche, das zu einem Mangel an Vertrauen und Motivation unter den Mitarbeitenden geführt habe. Der Bericht wirft Courtet «erhebliche Führungsdefizite und oft unangemessenes Verhalten» vor, auch wenn keine rechtswidrigen Handlungen vorliegen würden.

Courtet räume der Zufriedenheit seiner Wählerschaft mehr Priorität ein als dem Engagement seiner Untergebenen, was sich in zahlreichen Abgängen von Führungspersonen widerspiegelt, heisst es in dem Bericht weiter.
Auch die Zusammenarbeit mit den Regierungskollegen sei problematisch. Die Dynamik innerhalb des Gremiums sei «nicht zufriedenstellend», die Zusammenarbeit mit Courtet gestalte sich «ineffizient, unangenehm und manchmal geradezu unmöglich». Als Reaktion auf den Bericht hat der Gesamtregierungsrat Courtet die Zuständigkeit für die Dienststelle entzogen, die für die überobligatorische Bildung zuständig ist.
Der Bericht rät Courtet dazu, «einen neuen Karriereweg einzuschlagen, der seinen Talenten besser entspricht». Dieser zeigte sich bei der Präsentation des Berichts selbstkritisch und kündigte an, sein Management verbessern und an seiner Führungskompetenz arbeiten zu wollen. Einen neuen Karriereweg will Courtet aber offensichtlich nicht einschlagen. Das zeigt seine Ankündigung einer parteiunabhängigen Kandidatur.
Die Affäre um Martial Courtet ist der zweite Fall eines Regierungsmitglieds in der Westschweiz, der das Vertrauen des Kollegiums verliert und Zuständigkeiten über wichtige Dossiers abgeben muss. Ende März entzog der Waadtländer Staatsrat Regierungsrätin Valérie Dittli (Mitte) die Zuständigkeiten für Finanzen und Steuern. (cbe)
13:30 Uhr
Montag, 25. August
Trotz Tariferhöhung: Spitäler sehen keine finanzielle Entspannung

Die Spitäler kommen auf keinen grünen Zweig. Das zeigen die Finanzdaten von 90 Prozent aller Schweizer Spitäler und Kliniken, die der Verein SpitalBenchmark ausgewertet hat. Konkret schreiben viele Spitäler nicht ausreichend Gewinn, um die nötigen oder bereits umgesetzten Investitionen zu tätigen. Die Gewinnmarge vor Steuern und Abschreibungen liegt im Schnitt bei vier Prozent. Der Spitalverband Hplus spricht von einem «düsteren Bild».
Dies obwohl die Spitaltarife 2024 erhöht wurden. Hplus erklärt über eine Medienmitteilung, der Teuerungsschub zwischen 2021 und 2023 sei damit «nicht annähernd ausgeglichen» worden. Hplus-Direktorin Anne-Geneviève Bütikofer sagt: «Die in harten Verhandlungen erreichten Tariferhöhungen primär im stationären Bereich sind leider nur ein Tropfen auf den heissen Stein.» Die Spitäler könnten so wirtschaftlich nicht nachhaltig arbeiten.
Bütikofer verlangt eine «sofortige Tariferhöhung um mindestens 5 Prozent». Und sie verlangt, dass künftig die Tarife jeweils automatisch an die Teuerung angepasst werden. Das ist eine Forderung, die im Parlament hängig ist. (wan)
13:10 Uhr
Freitag, 22. August
Waadtländer Regierungsrätin fällt wegen Krankheit aus

Die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz (SP) kann ihr Regierungsratamt derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Ihre Absenz wird voraussichtlich einen Monat lang dauern, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Die Rückkehr wird in Absprache mit den Ärzten erfolgen. Laut dem Communiqué leidet Ruiz an physischen Problemen, die nun genauer untersucht werden. Präzisere Angaben hat die Kanzlei «zu gegebener Zeit» in Aussicht gestellt. Während ihrer Abwesenheit wird sie durch die Regierungsräte Frédéric Borloz (FDP) und Vassilis Venizelos (Grüne) vertreten.
Rebecca Ruiz ist 43 Jahre alt. Die ehemalige Nationalrätin wurde 2019 anstelle von Pierre-Yves Maillard in die Waadtländer Regierung gewählt. Ruiz ist Mutter von zwei Kindern. (kä)
11:50 Uhr
Freitag, 22. August
Nach Nacht in grösster Not: Deutsche Bergsteiger vom Breithorn gerettet
Nach einer Nacht in grösster Not sind am Breithorn in den Walliser Alpen zwei deutsche Bergsteiger gerettet worden. Die beiden Männer wurden mit einem Helikopter von der italienischen Bergwacht in etwa 4.000 Metern Höhe aufgegriffen und ausgeflogen. Sie werden nun in einem Krankenhaus in Aosta in Italien behandelt. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben der Bergwacht «insgesamt gut».

Die beiden Männer hingen seit Donnerstag in eisiger Kälte in der Nähe des Gipfels fest. Auf dem Weg nach unten hatte sich ihr Seil festgeklemmt. Ein weiteres Seil, um den Abstieg fortzusetzen, hatten sie nach Angaben der Bergwacht nicht. Mehrere Versuche, sie mit einem Helikopter nach unten zu bringen, scheiterten an den Wetterbedingungen: Die Sicht war zu schlecht. Zudem herrscht aktuell in der Gegend hohe Lawinengefahr.
Eine Nacht zwischen Schnee und Eis
Am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr kam dann doch ein Helikopter von der italienischen Seite zu ihnen durch. Die beiden hatten Zuflucht an einer verhältnismässig windgeschützten Stelle gesucht, wo sie dann zwischen Schnee und Eis auch die Nacht verbrachten. Mit einer Leuchte konnten sie dann auf sich aufmerksam machen. Zudem bestand übers Handy Verbindung.
Das Breithorn ist ein Bergkamm in den Walliser Alpen, im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Italien. Der höchste Punkt ist der Westgipfel mit 4160 Metern. Bestiegen wird das Massiv in der Regel von Schweizer Seite über die Station Klein Matterhorn. Zur Herkunft und zur Identität der beiden Männer machte die Bergwacht zunächst keine näheren Angaben.
Helikopter mussten mehrfach kehrt machen
Das Breithorn gilt als einer der Viertausender in den Alpen, die verhältnismässig leicht zu besteigen sind. Der Schweizer Alpen-Club SAC spricht jedoch auch von einer «gewaltigen vergletscherten Mauer mit mehreren Gipfeln». Am Donnerstag waren mehrere Rettungsversuche noch gescheitert. Von Schweizer Seite musste ein Helikopter der Air Zermatt unverrichteter Dinge wieder kehrt machen.
Die Rettung gelang dann mit einem Helikopter der italienischen Bergwacht. Zwischenzeitlich war auch überlegt worden, die beiden Männer mit einem Bergsteiger-Team herauszuholen. Nach Angaben der Rettungskräfte wäre eine Bergung zu Fuss jedoch wegen der derzeit hohen Lawinengefahr sehr gefährlich gewesen. Zudem gibt es in dem Gebiet zahlreiche Gletscherspalten. (cbe/dpa)
14:24 Uhr
MITTWOCH, 20. AUGUST 2025
Bundesrat will keine Gebühr für Notfälle
Der Bundesrat erteilt der Idee einer zusätzlichen Gebühr für Konsultationen in Spitalnotaufnahmen eine Absage. Mittels parlamentarischer Initiative wollte die GLP Kantone dazu ermächtigen, von Patientinnen und Patienten einen Zuschlag von bis zu 50 Franken auf den Selbstbehalt zu verlangen. Ziel war es, Bagatellfälle aus den Notfallstationen fernzuhalten und damit das Kostenwachstum im Gesundheitsbereich zu dämpfen.
Die Gesundheitskommission weitete diesen Vorschlag im Rahmen ihrer Beratung aus und wollte die Gebühr auf alle Personen erheben, die ohne schriftliche Überweisung in eine Notaufnahme gelangen. Von dieser Regelung ausgenommen wären nur Schwangere, Kinder und Personen, die von der Sanität in die Spitalnotaufnahme eingeliefert werden. Der Vorstoss geht zurück auf alt Nationalrat Thomas Weibel, übernommen hat ihn Martin Bäumle.
Geht es nach dem Bundesrat, wird daraus nichts. Eine solche Abgabe würde die Notaufnahmen kaum entlasten, schreibt die Regierung in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zwar sei die Überlastung vieler Spitalnotfälle ein reales Problem, doch eine Lenkungswirkung sei fraglich. «Insbesondere zu Randzeiten und an Wochenenden ist die Notaufnahme der einzige Zugang zu medizinischer Versorgung», heisst es in der Mitteilung. Damit fehle eine echte Alternative im Krankheitsfall.
Die Regierung steht mit ihrer Einschätzung nicht allein: Spitäler, Ärztinnen und Ärzte, Versicherer und Kantone lehnen die Idee grossmehrheitlich ab. Oder, wie es Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider formulierte: «Weder bei den Kantonen noch bei den Leistungserbringern hat die Notfallpauschale grosses Interesse geweckt.» In der Vernehmlassung sprachen sich fast 90 Prozent dagegen aus.
Ein weiterer Knackpunkt ist der Verwaltungsaufwand. Kantone müssten ihre Gesetze anpassen, Informationskampagnen starten und Kontrollen aufbauen. Versicherer wiederum hätten die Aufgabe, im Einzelfall zu prüfen, ob eine Überweisung vorliegt oder eine Ausnahme greift. Spitäler und Ärztinnen müssten dazu entsprechende Nachweise ausstellen und kontrollieren. Dieser bürokratische Mehraufwand würde zusätzliche Kosten verursachen – mit fragwürdigem Nutzen.
Sinnvoller sei es, die Grundversorgung zu stärken, etwa durch bessere Erreichbarkeit von Hausärzten oder Telemedizin, findet der Bundesrat. Auch Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung könnten helfen, die Notaufnahmen für jene frei zu halten, die sie wirklich brauchen. (bro)
10:15 Uhr
MITTWOCH, 20. AUGUST 2025
Co-Präsidium ist bei FDP wahrscheinlich: Leutenegger verzichtet

Am heutigen Mittwoch läuft die Bewerbungsfrist ab, bald wird klar, wer für die Nachfolge von FDP-Präsident Thierry Burkart ins Rennen steigt. Der Luzerner Ständerat Damian Müller, der als Kronfavorit galt, hat am Samstag überraschend abgesagt. Deshalb kam übers Wochenende Bewegung in die Sache: Filippo Leutenegger, Präsident der Kantonalzürcher FDP, wurde ins Spiel gebracht. Die Idee: Er solle bis zu den Wahlen 2027 als «Übergangspapst» die nationale Partei leiten. Nachdem dieses Portal gestern die Planspiele publik gemacht hatte, erhielt Leutenegger, 72, viel Zuspruch – und bei einer Online-Umfrage der «Weltwoche» schwang er mit 64 Prozent obenaus, vor Nationalrat Marcel Dobler mit 22 Prozent.
Trotzdem hat sich Leutenegger nun gegen eine Kandidatur entschieden, wie er am Mittwochvormittag zu CH Media sagt: «Ich konzentriere mich auf das letzte Jahr als Stadtrat und auf das sehr intensive Präsidium der FDP des Kantons Zürich.» Offenbar spielt noch ein anderer Grund mit: Bei der nationalen Partei scheint es auf ein Co-Präsidium hinauszulaufen, und Leutenegger ist kein Freund dieses Modells. Politologe Michael Hermann hat dem Modell «Übergangspapst» viel Positives abgewonnen: «Das Amt des FDP-Präsidenten ist zurzeit undankbar, darum spricht vieles für die Option Leutenegger, falls es diese gibt.» Sein Profil wäre «nahezu ideal». Diese Option ist nun vom Tisch. (pmü)
16:33 Uhr
Dienstag, 19. August
Ermittlungen gegen Ordensbruder: Es geht um Pornografie
In der Medienmitteilung sprach das Bistum Chur letzte Woche von einem nicht genauer definierten «mutmasslichem Fehlverhalten» gegenüber einer minderjährigen Person. Jetzt ist klar, weshalb die Staatsanwaltschaft Glarus gegen einen Ordensbruder des Franziskanerklosters Mariaburg in Näfels ermittelt: Es geht um Pornografie. Dies sagte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von CH Media. Der Kleriker steht im Verdacht, einer unter 16 Jahre alten Person eine Bilddatei mit pornografischem Inhalt übermittelt zu haben.
Gegen den Ordensbruder war vor etwa zwei Monaten Anzeige erstattet worden. Der Mann erteilte in einer Glarner Pfarreigemeinde in zwei Klassen Religionsunterricht. Gemäss dem Bistum Chur darf er bis auf Weiteres das Schulgelände nicht betreten. Der Religionsunterricht für die betroffenen Schüler wurde neu organisiert und findet wie gewohnt statt. (kä)
15:43 Uhr
Montag, 18. August
Abschaffung des Eigenmietwerts: Ja-Lager präsentiert Argumente
Am 28. September stimmt die Bevölkerung über eine Verfassungsänderung ab. Diese erlaubt den Kantonen, eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften einzuführen. Diese Vorlage ist rechtlich verknüpft mit der Abschaffung des Eigenmietwerts, die das Parlament Ende 2024 nach jahrelanger Debatte beschlossen hat. Die Besteuerung des Eigenmietwerts wird nur abgeschafft, wenn die Objektsteuer auf Zweitliegenschaften angenommen wird.

Am Montag traten die Befürworter des Systemwechsels vor die Medien. Gleich sieben Mitglieder von National- und Ständerat aus SVP, FDP, Mitte und GLP präsentierten ihre Argumente. «Dieses System ist ungerecht, bestraft die selbstnutzenden Wohneigentümer und widerspricht dem Verfassungsauftrag der Wohneigentumsförderung», sagte SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH), Präsident des Hauseigentümerverbands. Er zitierte den früheren SP-Finanzminister Otto Stich, der sich bereits in seiner Amtszeit (1984 bis 1995) für die Abschaffung des Eigenmietwerts ausgesprochen hatte.
GLP-Nationalrat Martin Bäumle sagte, die Reform beseitige Fehlanreize. Heute würden Schuldzinsen steuerlich begünstigt. Wer seine Hypothekarschulden reduziere, werde hingegen bestraft. Ein solches Steuersystem sei «dringend reformbedürftig». Mehrere Referenten betonten, die Reform sei anders als bei früheren Anläufen ausgewogen und gerecht. Im Gegenzug für die Abschaffung der Besteuerung des Eigenmietwerts fielen auch alle Abzüge für Hausbesitzer weg. Bauernpräsident Markus Ritter (Mitte/SG) wies darauf hin, dass die Vorlage auch die Forderungen der Linken in der parlamentarischen Debatte berücksichtige. SP und Grüne haben der Reform bis kurz vor der Schlussabstimmung mehrheitlich zugestimmt. Nun gehören sie dem Nein-Lager an. (cbe)
15:25 Uhr
Freitag, 15. August
Kampfwahl um Bundeshaus-Posten: Aargauerin fordert Zürcherin heraus

Im Bundeshaus kommt es in der Mitte-Fraktion zu einer Kampfwahl. Kurz vor Anmeldeschluss hat am Freitag die Aargauer Nationalrätin Maya Bally ihre Kandidatur für das Fraktionspräsidium eingereicht. «Das Amt interessiert mich riesig», sagt die 64-Jährige. «Mit meiner Erfahrung kann ich viel einbringen», sagt Bally, die seit 2023 im Nationalrat sitzt. Zuvor war sie von 2013 bis 2016 Fraktionschefin der BDP im Grossen Rat und bis zu ihrer Wahl in den Nationalrat zwei Jahre Vizefraktionspräsidentin der Mitte im Aargau. «Transparente Kommunikation und lösungsorientierte Sachpolitik sind ihr wichtig», heisst es in einem Communiqué der Mitte-Partei über Maya Bally.
Die Aargauerin fordert die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin heraus, die am Donnerstag ihre Kandidatur angekündigt hat. «Ich finde es gut, dass die Fraktion eine Auswahl hat», sagt Bally zur Ausgangslage. (sbü.)
11:52 Uhr
Freitag, 15. August
Schweizer Rettungsdienste löschen Brände in Montenegro

Im Mittelmeerraum brennen die Wälder, in Montenegro besonders heftig. Die Brände bedrohen die Hauptstadt Podgorica und weitere Landesteile. Alle nationalen Mittel von der Armee über die Feuerwehr und Freiwillige sind mobilisiert. Doch das reicht nicht: Wegen der anhaltenden Winde breiten sich die Feuer weiter aus und werden teils unkontrollierbar. Montenegro hat deshalb um internationale Hilfe gebeten - und Antwort aus der Schweiz bekommen.
Seit Freitagmorgen sind 22 Feuerwehrleute aus Westschweizer Brand- und Rettungsdiensten in den betroffenen Gebieten im Einsatz, wie es in einer Mitteilung des Bundes heisst. Mit drei Lösch- und mehreren Unterstützungsfahrzeugen bekämpfen sie Vegetationsbrände, schützen zentrale Punkte und verstärken die lokalen Mittel vor Ort.
Der Einsatz ist die erste gemeinsame Operation dieser Art. Er erfolgt im Rahmen eines Kooperationsabkommens, welches die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) mit den Genfer Rettungsdiensten abgeschlossen hat. (leh.)
16:01 Uhr
Donnerstag, 14. August
Ermittlungen gegen Ordensbruder in Glarus
Die Staatsanwaltschaft Glarus ermittelt gegen einen Ordensbruder des Franziskanerklosters Mariaburg in Näfels wegen eines mutmasslichen Fehlverhaltens gegenüber einer minderjährigen Person. Das teilte das Bistum Chur am Donnerstag mit. Der Ordensbruder erteilte in einer Glarner Pfarreigemeinde in zwei Klassen Religionsunterricht. Er darf bis auf Weiteres das Schulgelände nicht betreten. Er befindet sich nicht in Untersuchungshaft. Der Religionsunterricht für die betroffenen Schüler wurde neu geregelt und findet wie gewohnt statt.
Um was für ein Fehlverhalten es sich genau handelt und ob es sich um ein Sexualdelikt handelt, bleibt vorerst unklar. «Das werden die Ermittlungsbehörden klären müssen», sagt der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain. Für den Religionsunterricht sind im Kanton Glarus die Pfarreien zuständig. Der Kanton Glarus gehört zum Bistum Chur. (kä)
11:20 Uhr
Donnerstag, 14. August
Mitte sucht Fraktionschefin: Yvonne Bürgin stellt sich zur Wahl

Nach der Wahl von Philipp Bregy zum neuen Parteipräsidenten ist bei der Mitte das Fraktionspräsidium vakant. Bregy hatte das Amt seit 2021 inne.
Nun wagt sich eine Interessentin aus dem Busch: Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin hat am Donnerstag ihre Kandidatur bekanntgegeben. «Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen – für eine starke Mitte, die Brücken baut und unser Land zusammenhält», wird Bürgin in einer Mitteilung der Kantonalpartei zitiert.
Bürgin sitzt seit 2023 im Nationalrat und war zuvor bereits Fraktionschefin der Mitte im Zürcher Kantonsrat. Sie ist Vizepräsidentin der nationalen Partei und Gemeindepräsidentin von Rüti ZH.
St. Galler Nationalrat Paganini verzichtet

Aufgrund der neuen Ausgangslage verzichtet derweil Nicolò Paganini auf eine Kandidatur. Der St. Galler Nationalrat sagt, das Amt des Fraktionschefs hätte ihn gereizt. «Doch nun stellt sich eine Frau zur Verfügung, die bereits Erfahrung als Fraktionschefin hat.» Vor dem Hintergrund, dass mit Bundesrat Martin Pfister und Parteipräsident Philipp Matthias Bregy bereits zwei Männer wichtige Spitzenämter der Partei besetzen, solle nun der Anspruch der Frauen erfüllt werden. «Meine Kandidatur wäre nicht opportun», sagt Paganini.
Auch die Waadtländer Nationalrätin Isabelle Chappuis, die als mögliche Nachfolgerin Bregys gehandelt worden war, teilt auf Anfrage mit, auf eine Kandidatur zu verzichten. Eine weitere gehandelte Kandidatin, die Freiburger Ständerätin Isabelle Chassot, hat sich bisher nicht in die Karten blicken lassen. Die Bewerbungsfrist fürs Fraktionspräsidium läuft am Freitag ab.
13:09 Uhr
Mittwoch, 13. August
Bund: Die Zahlen werden weniger rot
Das Loch im Bundeshaushalt wird kleiner. In der aktuellen Hochrechnung geht der Bund von einem deutlich geringeren Defizit aus. Statt einem Minus von 800 Millionen Franken, rechnen die Expertinnen und Experten nun mit 200 Millionen Franken Aufwandüberschuss. «Die Verbesserung erklärt sich vor allem durch deutlich höhere Fiskaleinnahmen», schreibt die Finanzverwaltung in einer Mitteilung.
Gleichzeitig sind auch die ordentlichen Ausgaben leicht höher ausgefallen. Ohne diese Steigerung wäre auch eine rote Null in der Rechnung möglich gewesen. Gleichzeitig warnt der Bundesrat vor aufkeimender Euphorie. Die bessere Prognose ändere nichts daran, «dass in den Finanzplanjahren ohne Umsetzung des Entlastungspakets mit Milliardendefiziten zu rechnen wäre», heisst es in der Mitteilung.
Die Auswirkungen der hohen US-Zölle würden in diesem Jahr voraussichtlich keine «einschneidenden Folgen» für den Bundeshaushalt haben. Aktuell sei unsicher, «wie sich die Schweizer Wirtschaft auf diese neue Situation einstellen wird». Ab 2026 könnte es Einfluss mit vermehrter Kurzarbeit und bei der Mehrwertsteuer haben. (mg)
13:02 Uhr
Mittwoch, 13. August
Weiterhin Extrawurst für die Hotelbranche
Für die Hotellerie und Parahotellerie soll auch mittelfristig ein tieferer Mehrwertsteuersatz gelten. Der Bundesrat will den Sondersatz von 3,8 bis 2035 beibehalten. Damit kommt er zumindest teilweise einem Auftrag des Parlaments nach, das eine entsprechende Verlängerung forderte. Bereits da hatte sich die Regierung gegen das Ansinnen gestellt: «Der Tourismussektor ist heute in einer deutlich besseren wirtschaftlichen Lage befindet als zum Zeitpunkt der Einführung des Sondersatzes im Jahr 1996», heisst es in der Mitteilung.
Mit der Befristung auf 8 Jahre - bis 2027 gilt sowieso der tiefere Satz - kommt - will der Bundesrat nun aber doch etwas weniger weit gehen, als eigentlich gefordert wurde. Es gab auch Stimmen, die eine unbefristete Verlängerung forderten. Nach 2035 könne im Rahmen der neuen Finanzordnung diskutiert werden, ob Hotels künftig weniger Mehrwertsteuer abgeben müssen. Jährlich entgehen dem Bund geschätzt 300 Millionen Franken für die Jahre der Verlängerung. «Diese müssen aufgrund der Schuldenbremse an anderer Stelle kompensiert werden», schreibt das zuständige Departement. (mg)
14:06 Uhr
12. August
Kommission des Ständerats lehnt Halbierungsinitiative ab
Mit der sogenannten Halbierungsinitiative will ein von SVP-Exponenten dominiertes Komitee die jährlichen Radio- und Fernsehgebühren von 335 auf 200 Franken senken; Unternehmen sollen ganz davon befreit werden. Die Fernmeldekommission des Ständerats lehnt das Volksbegehren mit 12 zu 1 Stimmen ab, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Bereits im Juni hatte sich das Plenum des Nationalrats mit 116 zu 74 Stimmen dagegen ausgesprochen.
Für die ständerätliche Kommission genügen die Massnahmen, die Medienminister Albert Rösti der Initiative auf Verordnungsstufe entgegenstellt: Bis 2029 soll die Medienabgabe auf 300 Franken reduziert werden, und 80 Prozent der Unternehmen müssen sie künftig nicht mehr entrichten. Bereits dieser Schritt stellt in den Augen der Kommission eine Herausforderung dar, in allen Sprachregionen ein gleichwertiges publizistisches Angebot bereitzustellen.
Beim Volk würde die Halbierungsinitiative derzeit durchfallen: Gemäss einer repräsentativen Umfrage des Portals watson.ch sind aktuell 56 Prozent klar oder eher dagegen. Einzig die Mehrheit der SVP-Wähler spricht sich dafür aus. (kä)
10:22 Uhr
Bund schliesst Zuger Krankenkasse
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) greift durch: Es entzieht der Zuger Krankenkasse KLuG die Bewilligung, nachdem diese in massive finanzielle Schieflage geraten ist. Der Bund erklärt die Krankenkasse für insolvent, per Ende Jahr muss sie den Betrieb einstellen. 9300 Personen, die bei der Krankenkasse versichert sind, sind betroffen.
Man habe die Kasse wegen finanzieller Schwierigkeiten seit zwei Jahren intensiv überwacht, so das Bundesamt für Gesundheit. Verschiedene Massnahmen seien bereits ergriffen worden, um sie wieder zu stabilisieren. So hat der Bund der KLuG schon Mitte vergangenen Jahres eine aussergewöhnliche Prämienerhöhung befohlen.
Doch nun sind weitere Ungereimtheiten in der Buchhaltung aufgetaucht. Der Vorstand der Krankenkasse habe - nach Hinweisen aus der Geschäftsleitung - festgestellt, «dass Leistungen in Höhe von rund 2,4 Millionen Franken buchhalterisch nicht erfasst worden sind». So schreibt es das BAG. Damit habe sich «das Bild der Finanzen unerwartet und entscheidend verschlechtert».
Die betroffenen Versicherten müssen nun die Krankenkasse wechseln. Sie erhalten ein Angebot von der Helsana. Wer bis Ende Jahr keine andere Kasse wählt, wird automatisch von der Helsana übernommen.
09:45 Uhr
Dienstag, 12. August
Überwältigende Mehrheit für Handyverbot an Schulen
Das Thema ist allgegenwärtig: Die Kantone Aargau und Nidwalden verbannen Handys ab dem neuen Schuljahr aus den Schulen, in anderen Kantonen laufen derzeit ähnliche Debatten. Der Cybersorgen-Monitor der Versicherung AXA zeigt nun, dass 81 Prozent der Befragten dieser Massnahme zustimmen. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo mit 1’706 Teilnehmenden hervor.
80 Prozent würden zudem soziale Medien wie TikTok für Kinder unter 16 Jahren verbieten. «Das zeigt, dass ein grosses Bedürfnis besteht, Kinder in der Online-Welt zu schützen. Die Schweizer Bevölkerung findet, es brauche jetzt politische Massnahmen», sagt Sotomo-Leiter und Politbeobachter Michael Hermann.
Der Umgang mit Smartphones ist konfliktbeladen: Gemäss der Umfrage geben 55 Prozent der befragten Eltern an, gelegentlich oder häufig Streit über die Bildschirmzeit zu haben. (kä)
07:07 Uhr
Dienstag, 12. August
FDP-Präsidium: Andri Silberschmidt nimmt sich aus dem Rennen
Andri Silberschmidt will definitiv nicht neuer FDP-Präsident werden. Für seine Lebenssituation sei es heute einfach zu früh, sagte der Zürcher Nationalrat in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». «Darum verzichte ich.» Der 31-jährige Silberschmidt ist amtierender FDP-Vizepräsident und gilt als Hoffnungsträger der Partei.

Seine Nichtkandidatur hat auch damit zu tun, dass er soeben Vater geworden ist. Es sei ihm ein Anliegen, sein Kind (oder seine Kinder?) beim Aufwachsen begleiten zu können. Zudem habe er mit seinem Partner eine Firma aufgebaut – die Gastrokette Kaisin mit 120 Angestellten. In eineinhalb Jahren finden die Zürcher Wahlen statt. Silberschmidt sagte im Interview, er überlege sich eine Kandidatur als Regierungsrat. Bevor er einen Entscheid treffe, wolle er sich aber noch mit der Zürcher FDP austauschen. (kä)
17:45 Uhr
Donnerstag, 8. August
Geköpfte Katze: Es war ein Wildtier
Am Dienstagnachmittag fand eine Frau in Schaffhausen ihre Katze tot im Garten, ohne Kopf und ohne Schwanz. Die Polizei ging zunächst von Tierquälerei und einer mutwilligen Tötung aus und suchte Zeugen. Am Donnerstagnachmittag teilte die Schaffhauser Polizei nun mit, dass die Katze durch ein Wildtier getötet und verstümmelt wurde. Dies hätten veterinärpathologische Untersuchungen ergeben. Die Polizei stellte darauf ihre Ermittlungen ein. (kä)
07:20 Uhr
Mittwoch, 6. August
Karin Keller-Sutter trifft US-Aussenminister Marco Rubio
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wird sich am Mittwoch um 16.15 Uhr Schweizer Zeit mit US-Aussenminister Marco Rubio treffen. Das gab das US-Aussenministerium bekannt. Details zum Treffen, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, sind noch nicht bekannt.
Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin sind bereits am Dienstagabend in Washington DC eingetroffen, um über die Strafzölle auf Schweizer Produkte zu verhandeln. (fan)
15:47 Uhr
Dienstag, 5. August
«Bis zu 250 Prozent»-Zölle für Pharma
Dass US-Präsident Donald Trump die hohen Medikamentenpreise ein Dorn im Auge sind, ist bereits seit längerem bekannt. Nun droht er der ausländischen Pharmabranche mit drastischen Mitteln: «Wir werden zunächst einen kleinen Zoll auf Medikamente erheben, aber in einem Jahr, maximal anderthalb Jahren, wird er auf 150 Prozent steigen und dann auf 250 Prozent», sagte Trump in einem Interview gegenüber dem Fernsehsender CNBC.
Trump ging im Interview auch explizit auf die Schweiz ein. Diese mache ein Vermögen mit Arzneimitteln, sagte er am Telefon. «Wir wollen, dass Arzneimittel in unserem Land hergestellt werden.» (bro)
12:18 Uhr
Dienstag, 5. August
Keller-Sutter und Parmelin reisen in die USA
Die Schweiz will im Zollstreit mit den USA weiterverhandeln und ein attraktiveres Angebot unterbreiten. Das hat der Bundesrat an seiner Krisensitzung am Montag entschieden.
Nun gibt er bekannt: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin fliegen bereits heute Dienstag nach Washington, um kurzfristige Treffen mit den US-Behörden zu ermöglichen und Gespräche im Hinblick auf eine Verbesserung der Zoll-Situation der Schweiz führen zu können.
Die beiden Bundesräte werden von einer kleinen Delegation begleitet, insbesondere von Helene Budliger Artieda, Staatssekretärin für Wirtschaft (SECO), und Daniela Stoffel, Staatssekretärin für internationale Finanzfragen (SIF). Ziel sei es, den USA ein attraktiveres Angebot zu unterbreiten, um die Höhe der Zusatzzölle für die Schweizer Exporte zu verringern und dabei die Anliegen der USA zu berücksichtigen, heisst es in der Medienmitteilung.
Offen ist, wen die Schweizer Delegation treffen wird - und ob überhaupt schon Treffen fixiert worden sind. Der Bundesrat hält sich mit Details zurück. Er werde erst kommunizieren, sobald es für die Öffentlichkeit relevante Entwicklungen gebe. (dk)

12:17 Uhr
Montag, 4. August
Grenzwächter stoppen Fleischschmuggler
Grenzwächter haben am 11. März bei einer mobilen Kontrolle in Trübbach SG einen Fleischschmuggler erwischt. Der Syrer führte insgesamt 336 Kilogramm unverzollte und teilweise unverpackte Tierkörper sowie weitere Fleischwaren in einem Auto mit Schweizer Kennzeichen mit. Der Mann war von Österreich über den Grenzübergang Schellenberg in Liechtenstein eingereist, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) am Montag mitteilte. Es eröffnete gegen ihn eine Strafuntersuchung. Bazg-Mitarbeitende entsorgten das ungekühlte Fleisch fachgerecht.
Im vergangenen Jahr stellte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 208 Tonnen geschmuggeltes Fleisch sicher. Es führt derzeit rund zehn grössere Verfahren wegen gewerbsmässigen Schmuggels. Das Bundesamt bekämpft den Fleischschmuggel nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Oft wird das im Ausland produzierte Fleisch ungekühlt in einem Kofferraum verstaut. Durch die Unterbrechung der Kühlkette können sich Salmonellen oder andere Keime bilden. (kä)
16:35 Uhr
mittwoch, 16. juli
Nach Hackerangriff auf Bundesverwaltung: Ermittlung identifiziert russische Hacker
Im Zuge umfangreicher internationaler Ermittlungen konnten drei mutmassliche Schlüsselpersonen der pro-russischen Hackergruppe «NoName057(16)» identifiziert werden. Dies gab die Schweizer Bundesanwaltschaft am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.
Die Hackergruppierung hatte rund um eine Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vor der Bundesversammlung vom 15. Juni 2023 die Webseiten von mehreren Schweizer Behörden mithilfe sogenannter DDoS-Attacken lahmzulegen versucht - und war dabei teilweise erfolgreich.
Noch im selben Monat eröffnete die Bundesanwaltschaft wegen der Angriffe ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Das Fedpol initiierte daraufhin internationale Ermittlungen, die von Europol koordiniert worden sind. Dabei kam es zu Polizeiinterventionen in mehreren Ländern, bei denen Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen von am Netzwerk beteiligten Computern sowie Festnahmen erfolgt sind.
In der Folge gelang es, drei mutmassliche Schlüsselpersonen von «NoName057(16)» zu identifizieren. Die Bundesanwaltschaft dehnte ihr Strafverfahren auf diese drei Personen aus und hat diese zur Verhaftung ausgeschrieben. Bis sie verhaftet werden können, will die Bundesanwaltschaft das Strafverfahren sistieren.
In der Schweiz seien keine beteiligten Computer oder Personen identifiziert worden können, schreibt die Bundesanwaltschaft.

Der Cyberangriff rund um die Selenski-Rede im Juni 2023 war nicht die einzige Aktion der Hackergruppe gegen die Schweiz. «NoName057(16)» bekannte sich zu mehreren DDoS-Attacken auf Webseiten von Schweizer Behörden und staatsnaher Unternehmen. Dazu gehörten Cyberangriffe rund um einen Ukraine-Besuch des damaligen Bundespräsidenten Alain Berset im November 2023, während der jährlichen WEF-Treffen in Davos 2024 und 2025 sowie während der Bürgenstock-Friedenskonferenz im Juni 2024 und des Eurovision Song Contest im Mai 2025 in Basel.
DDoS steht für «Distributed Denial of Service». Bei solchen Angriffen wird versucht, ein System mit einer Flut von Anfragen lahmzulegen. (cbe)
10:25 Uhr
Dienstag, 15. Juli
Ständerat Benjamin Mühlemann interessiert an FDP-Präsidium
Für die Nachfolge des zurücktretenden Parteipräsidenten Thierry Burkart taucht ein neuer Name auf dem Radar auf. Der Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann bezeichnete das Amt gegenüber Radio SRF als «sehr interessanten Posten», bei dem man auf der parteipolitischen Ebene mitgestalten und das liberale Gedankengut in die Schweiz hinaustragen könne.

Der 46-Jährige politisiert erst seit den Wahlen vom Herbst 2023 auf Bundesebene. Davor war er während über neun Jahren Mitglied der Kantonsregierung, ab Mai 2022 als Landammann. Seine relative Unerfahrenheit auf nationaler Ebene sieht Mühlemann nicht als Nachteil, auch wenn er laut eigener Einschätzung «bei den Dossierkenntnissen noch Potenzial hat». Er sei ein positiver Mensch und als Parteipräsident könne man viel gewinnen, wenn man es richtig mache, wird er im Radiobeitrag zitiert.
Gedanken über eine Kandidatur fürs Parteipräsidium machen sich auch der Luzerner Ständerat Damian Müller (40), der Zürcher Nationalrat und Parteivize Andri Silberschmidt (31), die St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (58) sowie Fraktionschef und Nationalrat Damien Cottier (50) aus Neuenburg. Sie alle wollen sich während der Sommerferien Gedanken machen und definitiv über eine allfällige Kandidatur entscheiden.
Die parteiinterne Anmeldefrist bei der Findungskommission läuft am 20. August ab. Den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Thierry Burkart wählt die freisinnige Delegiertenversammlung am 18. Oktober in Bern. (cbe)
17:15 Uhr
Mittwoch, 9. Juli
Lokale Presse erhält mehr Fördergelder
Das Referendum gegen die indirekte Presseförderung kommt nicht zustande. Das Komitee des rechtsbürgerlichen Team-Freiheit gab am Mittwoch bekannt, dass es die benötigten 50'000 Unterschriften «knapp verfehlt» habe. Die Frist ist nun abgelaufen. Das Komitee gibt verschiedene Gründe an: Es habe spät mit der Sammlung starten müssen. Und die Unterstützung der Parteien sei gering gewesen. Zusätzlich seien unterdurchschnittlich viele Unterschriftenbögen zurückgekommen.

Das bedeutet, dass Regional- und Lokalzeitungen weiterhin einen Beitrag für die Zustellung der Zeitungen erhalten. Bundesrat und Parlament wollen mit einer Aufstockung des Beitrags die Medienvielfalt stärken. Bisher zahlte der Bund 30 Millionen Franken pro Jahr für die Zustellung der Zeitungen, nun soll der Beitrag auf 40 Millionen Franken aufgestockt werden. Das hat das Parlament im März entschieden.
Auch die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse wird weiterhin subventioniert, mit einem Beitrag von 20 Millionen Franken. Neu wird zudem die Frühzustellung von Tages- und Wochenzeitungen unterstützt - mit 25 Millionen Franken pro Jahr. Die Subvention ist auf sieben Jahre beschränkt. Medienminister Albert Rösti hat angekündigt, dass er dann eine kanal-unabhängige Förderung vorsieht - und Subventionen auch für Online-Formate ermöglichen will. (chm)
18:15 Uhr
Montag, 7. Juli
Zürich will Jugendliche vor Geschlechtsumwandlungen schützen
Der Kanton Zürich stellt eine klare Forderung an den Bund: Er soll nationale Regeln schaffen, um Minderjährige vor «irreversiblen Eingriffen» zu schützen. Gemeint sind damit Änderungen des biologischen Geschlechts.

Als Begründung führt die Zürcher Gesundheitsdirektion von SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli die «geschlechtsangleichenden Operationen bei Minderjährigen» an, die «zuletzt vermehrt vorgenommen» wurden. Eine Analyse habe die Zunahme gezeigt. Zahlen dazu veröffentlicht der Kanton nicht.
Die Abklärungen des Amtes für Gesundheit haben «zusammenfassend keine Hinweise auf systemische Versorgungsmängel» bei der medizinischen Behandlung von «Minderjährigen mit Geschlechtsinkongruenz», schreibt die Gesundheitsdirektion.
Dennoch will Rickli als kantonale Massnahme Qualitätsstandards einführen, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt.. Als Sofortmassnahme hat sie bereits Anfang 2024 die Spitäler aufgefordert, geschlechtsangleichende Operationen bei Minderjährigen mit äusserster Zurückhaltung vorzunehmen.
Weiter schreibt die Gesundheitsdirektion, Eltern von Transgender-Jugendlichen hätten Vorbehalte geäussert, dass Behandlungen im Bereich der Geschlechtsinkongruenz zu vorschnell erfolgen. Als weiteres Argument führt die Regierung auf, dass Länder, die bisher eine «liberale» Praxis verfolgten, eine Abkehr von geschlechtsangleichenden Operationen erfolgte - etwa in Grossbritannien, Finnland und Schweden seien keine irreversiblen Operationen bei unter 18-Jährigen mehr erlaubt. Der Bund müsse darum nachziehen. (wan)
16:59 Uhr
Montag, 7. Juli 2025
Verzögerung bei Gotthard-Tunnelbau
Beim Bau der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels kommt es auf der Südseite zu geologischen Schwierigkeiten. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mitteilte, musste die Tunnelbohrmaschine nach nur 190 Metern gestoppt werden. Auf den nächsten rund 500 Metern machten lockeres, geklüftetes Gestein und Hohlräume eine Bohrung unmöglich. Das Bundesamt für Strassen hat daher entschieden, diesen Abschnitt konventionell im Sprengvortrieb auszubrechen.

Ein eigens dafür angelegter Verbindungsstollen soll den Sprengvortrieb in zwei Richtungen ermöglichen. Die Arbeiten werden laut Astra im Dreischichtbetrieb an sieben Tagen pro Woche durchgeführt und dauern voraussichtlich sechs bis acht Monate.
Allerdings verursacht die geänderte Vorgehensweise Mehrkosten von 15 bis 20 Millionen Franken. Die Gesamtkosten für die zweite Gotthardröhre belaufen sich auf rund 2,14 Milliarden Franken.
Trotz des Mehraufwands hält das Bundesamt für Strassen am Eröffnungstermin im Jahr 2030 fest. Auf beiden Tunnelportalen gehen die übrigen Arbeiten planmässig weiter. Um Verzögerungen zu vermeiden, zieht das Amt zudem andere Bauetappen vor und trifft weitere terminoptimierende Massnahmen. (cbe)
16:24 Uhr
Montag, 7. Juli
Fall Raiffeisen: Bei Journalist beschlagnahmte Datenträger bleiben versiegelt
Ein Zürcher Zwangsmassnahmengericht hat der Staatsanwaltschaft verboten, im Rahmen einer Anfang Juli in den Büroräumen des Onlineportals «Inside Paradeplatz» (IP) sowie der Privatwohnung von IP-Herausgeber und Journalist Lukas Hässig beschlagnahmtes Material auszuwerten. Dies schreibt Hässig auf «Inside Paradeplatz».

Die Staatsanwaltschaft führte die Razzia mit dem Segen des Zürcher Obergerichts durch und konfiszierte dabei Computer, Telefon, Dokumente und Notizbücher des bekannten Wirtschaftsjournalisten. Lukas Hässig liess das beschlagnahmte Material siegeln und wandte sich ans Zwangsmassnahmengericht.
Es bestehe «kein auch nur ansatzweise hinreichender Tatverdacht» für einen weitreichenden Eingriff wie eine Razzia mit folgenden Sicherstellungen, zitiert «Inside Paradeplatz» aus dem Urteil der zuständigen Bezirksrichterin.
Die Hausdurchsuchung fand auf Bestreben von Beat Stocker statt, dem Compagnon des langjährigen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz. Stocker machte geltend, dass Hässig und «Inside Paradeplatz» gegen Artikel 47 im Bankengesetz verstossen haben - und erhielt bei der Staatsanwaltschaft und beim Obergericht Gehör.
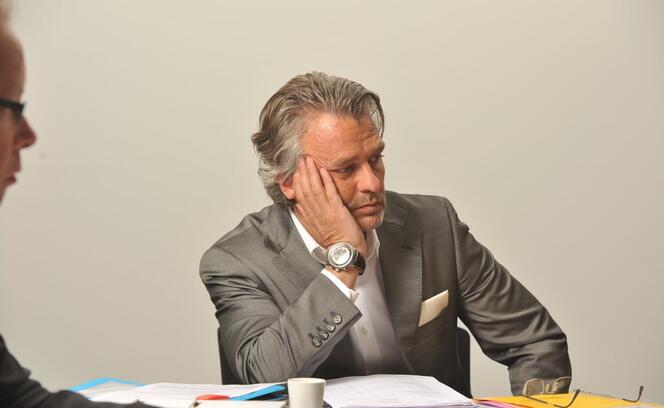
Unter diesem 2015 vom Parlament eingeführten, äusserst umstrittenen Artikel machen sich Medienschaffende unter Umständen strafbar, wenn sie Informationen, die als Bankgeheimnis gelten, auch bloss weiterverbreiten.
Das Zürcher Zwangsmassnahmengericht kommt in seinem Urteil jedoch zu einem eindeutigen Schluss. Es lasse sich «keine Bankgeheimnisverletzung bzw. ein gesetzwidriges Vorgehen (des Journalisten) plausibilisieren».
«Journalist handelte im Sinne der Gesellschaft»
Beat Stocker wurde im Zusammenhang mit Geschäften rund um die Raiffeisenbank bzw. Aduno wegen mehrfachen Betrugs oder Betrugsversuchs, mehrfacher Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung, mehrfacher passiver Privatbestechung sowie mehrfacher Verletzung des Geschäftsgeheimnisses in erster Instanz zu vier Jahren Gefängnis und einer bedingten Geldstrafen von 160 Tagessätzen à 3000 Franken verurteilt. Er hat dagegen Berufung eingelegt.
Lukas Hässig hatte dies mit seiner Berichterstattung auf Inside Paradeplatz ab 2016 ins Rollen gebracht. Die Bezirksrichterin schreibt in ihrem Urteil mit Blick auf die Güterabwägung zwischen den Interessen des Privatklägers Beat Stocker und der verfassungsmässig garantierten Medienfreiheit: «Mit seiner Publikation hat der [Journalist] somit im Sinne der Gesellschaft gehandelt und seine Aufgabe als investigativer Medienschaffender, mithin die Aufdeckung von möglichen Gesetzesverstössen sowie die ihm dabei obliegende Informationspflicht, wahrgenommen.»
Nach dem Urteil des Zwangsmassnahmengerichts darf die Staatsanwaltschaft die beschlagnahmten und in der Folge versiegelten Daten in ihrem Verfahren nicht verwenden. (cbe)
11:58 Uhr
Montag, 7. juli
Mitte-Nationalrat Philipp Kutter tritt als Stadtpräsident zurück
Der Zürcher Nationalrat Philipp Kutter tritt bei den kommunalen Wahlen vom April 2026 nicht mehr für das Amt des Stadtpräsidenten von Wädenswil an. Der 49-Jährige sitzt seit 2006 in der Exekutive der Gemeinde am linken Zürichseeufer, seit 2010 ist er Stadtpräsident.

Das Stadtpräsidium sei «eine wunderschöne Aufgabe, die ich bis heute mit viel Freude ausübe», wird Kutter in einer am Montag verschickten Medienmitteilung der Mitte Wädenswil zitiert. Er wisse jetzt schon, dass er das Amt vermissen werde. «Aber nach 16 Jahren ist der Moment gekommen, den Stab weiterzugeben», so Kutter weiter. Die Partei will den Sitz verteidigen. Man führe derzeit Gespräche mit mehrere geeigneten Persönlichkeiten und entscheide voraussichtlich nach den Sommerferien über eine Kandidatur.
Neben seinen Ämtern in der Wädenswiler Stadtregierung sass Kutter ab 2007 im Zürcher Kantonsrat. Bei den eidgenössischen Wahlen 2015 landete er auf der Nationalratsliste der Mitte-Vorgängerpartei CVP auf dem ersten Ersatzplatz. Im Jahr 2018 rutschte er nach dem Rücktritt von Barbara Schmid-Federer in den Nationalrat nach.
Im Februar 2023 brach sich Kutter bei einem einem schweren Skiunfall zwei Halswirbel. Er musste seine Ämter für mehrere Monate ruhen lassen. Seit seinem Unfall ist er auf einen Rollstuhl angewiesen und ist teilweise gelähmt. (cbe)
13:20 Uhr
Freitag, 4. Juli
So viele Schwangerschaftsabbrüche wie noch nie
In der Schweiz gab es im vergangenen Jahr so viele Schwangerschaftsabbrüche wie noch nie. Dies geht aus neuen Zahlen hervor, die das Bundesamt für Statistik am Freitag publiziert hat. Gesamthaft wurden letztes Jahr 12'205 Abbrüche gemeldet. Im Vorjahr waren es noch 300 weniger.
Der jetzige Wert entspricht einer Rate von von 7,3 Schwangerschaftsabbrüchen pro 1000 Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren, die in der Schweiz wohnen. Anders formuliert: 7 von 1000 Frauen in dieser Altersgruppe haben sich 2024 für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Der absolut grösste Teil davon (96 Prozent) erfolgte innert den ersten 12 Schwangerschaftswochen. Und meist (83 Prozent) medikamentös.
Regional zeigen sich grosse Unterschiede in der Quote. Sie liegt zwischen 5,1 Abbrüchen pro 1000 Frauen im Tessin, und 9 Abbrüchen pro 1000 Frauen in der Genferseeregion. In der Nordwestschweiz ging die Anzahl Schwangerschaftsabbrüche pro 1000 Frauen im vergangenen Jahr zurück. Im Mittelland und der Ostschweiz stiegen sie dagegen an. (mg)
13:27 Uhr
Schutz der Aare: Atomkraftwerk Beznau fährt beide Blöcke herunter
Das Atomkraftwerk Beznau hat am Mittwochabend Block 2 abgeschaltet, um die Erwärmung der Aare zu begrenzen. Block 1 war bereits seit Dienstag vom Netz, wie Axpo mitteilte.
Aufgrund hoher Wassertemperaturen hatte die Axpo die Leistung beider Reaktorblöcke seit Sonntag auf 50 Prozent reduziert. Die Massnahmen zur Drosselung und Abschaltung entsprechen den Vorgaben des Bundesamtes für Energie (BFE) und sollen das Ökosystem der Aare schützen. Ziel ist es, eine übermässige Erwärmung des Flusswassers in heissen Sommerperioden zu verhindern.
Aktuell wird die Aare mit 24.3 °C gemessen (Messstelle Kraftwerk Klingnau). Die Limmat, die beim Wasserschloss in die Aare fliesst, bringt dabei richtig warmes Wasser mit: In Baden wurden 26.4 °C gemessen. Ab 25 Grad wird das Atmen für die Fische schwierig. Wenn sie nicht in kälteres Wasser flüchten können, ist das lebensbedrohlich.

Die Abschaltungen der Beznau-Reaktoren erfolgen in Absprache mit der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat sowie der Übertragungsnetzbetreiberin Swissgrid. Damit werde laut Axpo sichergestellt, dass Versorgungssicherheit, Reaktorsicherheit und Netzstabilität nicht gefährdet sind.
Die beiden Blöcke des Atomkraftwerks Beznau produzieren im Vollbetrieb ca. 6000 Gigawattstunden im Jahr, also durchschnittlich etwa 16 bis 17 Gigawattstunden Strom pro Tag. Damit können rund 1,5 Millionen Haushalte in der Schweiz einen Tag mit Strom versorgt werden. (phh)
09:03 Uhr
Donnerstag, 3. Juli
«Zeitpunkt stimmt für mich nicht»: Maja Riniker erteilt FDP-Präsidium Absage
Nach der Ankündigung von Thierry Burkart, dass er als FDP-Präsident zurücktritt, wurde Riniker als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Im Gespräch mit Keystone-SDA stellt sie nun aber klar: «Der Zeitpunkt stimmt für mich nicht.» Sie werde nicht als Nachfolgerin zur Verfügung stehen.

Die seit letzten Dezember amtierende Nationalratspräsidentin und Aargauer FDP-Politikerin Maja Riniker will nicht FDP-Präsidentin werden. Das hat die 47-Jährige in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärt.
Sie verweist auf ihre aktuelle Aufgabe als Nationalratspräsidentin, die sie «viel Herzblut» ausführe. Danach freue sie sich, im nächsten Jahr wieder mehr Sachpolitik in ihren angestammten Dossiers betreiben zu können und wieder etwas mehr Zeit für die Familie zu haben. (luk)
16:00 Uhr
Mittwoch, 2. Juli
Schweiz einigt sich auf Freihandelsabkommen mit Mercosur
Für die entscheidenden Verhandlungen reiste Wirtschaftsminister Guy Parmelin gleich selbst nach Argentinien. Die Efta-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island haben sich mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay auf ein neues Freihandelsabkommen geeinigt.

Die Verhandlungen starteten bereits 2017. Das Abkommen soll Zolleinsparungen von bis zu 180 Millionen Franken pro Jahr für die Schweiz ermöglichen und ist damit – nach der EU und China – das Freihandelsabkommen mit dem grössten Zolleinsparungspotenzial für die Schweiz. Nebst Zöllen sollen auch technische Handelshemmnisse reduziert werden. Die Efta hat die Einigung bereits bestätigt, die Schweiz will im Laufe des späteren Nachmittages informieren.
Bereits kommt Kritik. Die Grünen befürchten, dass der Schutz des Regenwaldes sowie die Rechte der lokalen Bevölkerung dem Agrarfreihandel geopfert würden. Die Partei will das Referendum ergreifen, falls das Freihandelsabkommen keine griffigen Bestimmungen zum Schutz der Umwelt und der Menschenrechte enthalte, schreiben die Grünen in einer Medienmitteilung.
Genau das gelte es zu verhindern, schreibt hingegen Swissmem, der Verband der Schweizer Maschinenindustrie. Er ruft die Politik auf, den Genehmigungsprozess rasch voranzutreiben. «Ein Referendum wäre ein Affront gegenüber den schwer kämpfenden Industrie-KMU und den 330’000 Arbeitnehmenden in der Branche», schreibt Swissmem in einer Mitteilung. Er bezeichnet das Abkommen als Lichtblick für die gebeutelte Tech-Industrie. Angesichts von Zöllen, Handelskriegen und weltweiter Unsicherheit sei der Ausbau des Freihandelsnetzes zentral. Die Exportindustrie sei die Wohlstandslokomotive der Schweiz. (dk)
11:38 Uhr
Dienstag, 1. Juli
Untersuchung zum Kampfjet-Debakel eingeleitet
Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK) hat entschieden, den Kampfjet-Kauf des F-35 noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Das hat die Kommission am Dienstag mitgeteilt. Dabei soll auch «der Umgang mit den Gutachten zum Fixpreis sowie die Information des Bundesrates gegenüber der Oberaufsicht und der Öffentlichkeit vertieft werden».
Die GPK begründet das mit den neuen Entwicklungen rund um den Kampfjet. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Amerikaner nichts von einem Festpreis für den Kampfjet wissen wollen. Der Bundesrat hatte stets behauptet, man habe dies so vereinbart. Sollte das tatsächlich nicht mehr gelten, so könnten die 36 bestellten Kampfflugzeuge um bis zu 1,3 Milliarden Franken teurer werden. Das Stimmvolk hat einen Kreditrahmen von 6 Milliarden bewilligt.
Die GPK untersucht, ob «bei der Aushandlung der Verträge rückblickend Mängel in der Geschäftsführung des Bundesrates festgestellt werden können». Auch soll vertieft geprüft werden, wie sich die zuständigen Stellen «damals mit den vom VBS eingeholten Gutachten sowie den kritischen Empfehlungen der Finanzkontrolle zum Fixpreis aus dem Jahr 2022 auseinandergesetzt haben.» Präsident der zuständigen Subkommission ist der Luzerner SP-Nationalrat David Roth. (mg)
15:55 Uhr
Mittwoch, 25. Juni
Bundesrat will kein Geld für die Expo bezahlen
Der Bundesrat will kein Geld für eine Expo ausgeben. Eine allfällige Landesausstellung in den 2030er-Jahren müsste ohne Bundesmittel auskommen. Das hat die Regierung am Mittwoch entschieden. Die letzte Expo 2002 hat rund eine Milliarde Franken aus der Staatskasse bekommen. Der Bundesrat begründet seine Haltung mit der angespannten Finanzsituation. Das dürfte ein harter Schlag für die Veranstalter sein. Derzeit gibt es mehrere Projekte, die gerne eine Landesausstellung organisieren würden.
Ebenfalls wird die Schweiz vorerst keine Beauftragtenstelle gegen Rassismus und Antisemitismus erhalten. Das allerdings nicht aus finanziellen Gründen. Der Bundesrat verzichtet auf die Einführung, da es schon mehrere solcher Stellen gebe. Es bestehe die Gefahr von Doppelspurigkeiten und einem erhöhten Koordinationsbedarf. Das Parlament hatte eine entsprechende Stelle gefordert. Das nach der Häufung von antisemitischen Vorfällen nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten. (mg)
11:30 Uhr
Mittwoch, 25. Juni
Neues Reservekraftwerk an altem Standort
Schon seit längerem sucht der Bundesrat nach einer Nachfolgelösung für das Reservekraftwerk Birr. Der Vertrag mit der Firma General Electric läuft im Frühling 2026 aus. Nun ist der Bundesrat in der gleichen Gemeinde fündig geworden: Die Firma Ansaldo Energie soll ab Februar 2027 mit einem Gaskraftwerk bereitstehen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen, diese Zeitung hatte schon früher über die Pläne berichtet.

Zu reden dürften unter anderem die Kosten geben: Für das Reservekraftwerk verlangt die Regierung bei der Finanzdelegation einen Zusatzkredit von 275 Millionen Franken. Dies, nachdem dessen Vorgänger bereits eine halbe Milliarde Franken verschlungen hat. Der Prüfstand am Standort Birr hat eine Gasturbine des Typs GT 26 mit einer Leistung von 250 MW. Sie verfügt über eine Betriebsbewilligung für Tests von bis zu 800 Betriebsstunden pro Jahr. Die Kosten werden die Stromkundinnen und -kunden tragen.
Das neue Reservekraftwerk ist ebenfalls nur eine Übergangslösung bis voraussichtlich 2030. Dann sollen neue Kraftwerke bereitstehen. (bro)
09:40 Uhr
Mittwoch, 25. Juni
Bussen für Littering: 100 Franken pro Zigistummel
Wer seine Zigarette achtlos auf den Boden schnippt, dem droht künftig bald eine Busse in der Höhe von 100 Franken. Der Bundesrat will nationale Littering-Bussen einführen. Heute kennt bereits eine Mehrheit der Kantone eigene Geldstrafen für Littering. Der Auftrag zu einer schweizweiten Lösung stammt aus dem Parlament.
Für das unsachgerechte Entsorgen von mehreren Kleinabfällen (unter anderem Verpackungen, Dosen, Flaschen, Zeitungen) soll eine Busse von 200 Franken fällig werden. Werden Siedlungsabfälle in der Grössenordnung zwischen 35 und 60 Liter illegal entsorgt, werden 250 Franken fällig. Sind es mehr, werden es gar 300 Franken.
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch die entsprechenden Verordnungen in die Vernehmlassung geschickt. Nun können Kantone, Parteien und weitere Kreise ihre Meinung mitteilen. Die Bussen treten frühestens 2026 in Kraft. (mg)
16:35 Uhr
Kampfjet: Bundesrat Pfister will am Mittwoch informieren
Verteidigungsminister Martin Pfister sollte sich am Dienstag in der Sicherheitskommission des Nationalrats zu den angeblich explodierenden Kosten für den US-Kampfjet F-35 äussern. Tat er aber nicht. Pfister verwies darauf, so hört man in Bern, dass er am Mittwoch zuerst den Bundesrat informieren müsse. Was darauf hindeutet, dass es zuletzt eine neue Entwicklung gab. Nach dem Bundesrat sollen auch Parlamentarier mit diesen Informationen bedient werden, später auch die Medien beziehungsweise die Öffentlichkeit.
Bisher hiess es, 36 Jets würden maximal 6 Milliarden kosten, von einem Festpreis war die Rede. Angeblich verlangen die Amerikaner jetzt etwa 1,3 Milliarden Franken mehr; und der Bundesrat hat dies bisher öffentlich weder dementiert noch bestätigt. Die Schweiz kauft die Kampfjets nicht von Hersteller Lockheed direkt, sondern über die US-Regierung. Sie verhandelt mit Lockheed den Preis. (hay)
14:49 Uhr
Montag, 23. Juni 2025
Parmelin unterschreibt neues Palmöl-Abkommen
Die Schweiz will weniger Zölle auf malaysisches Palmöl erheben. Am Montag hat Bundesrat Guy Parmelin ein Freihandelsabkommen mit Malaysia unterzeichnet. Es erlaubt der Schweiz den zollfreien Export nach Malaysia für fast alle Produkte. Im Gegenzug gewährt die Schweiz eine Zollreduktion auf das malaysische Palmöl.

Sowohl die Grünen als auch verschiedene Umweltorganisationen drohen damit, das Abkommen bekämpfen zu wollen. Denn: Mehr als ein Drittel des in der Schweiz nachgefragten Palmöls stammt aus Malaysia. Das ist ein Vielfaches dessen, was die Schweiz aus Indonesien importiert. Schon 2021 wurde das Freihandelsabkommen mit Indonesien wegen der Palmölfrage nur knapp angenommen - gerade mal 51,4 Prozent stimmten dem Abkommen zu. (leh.)
15:39 Uhr
Freitag, 20. Juni 2025
Missbrauchsskandal in Walliser Abtei: Bericht zeigt Ausmass auf
Verdacht auf sexuelle Übergriffe, Fälle von Exhibitionismus, sexualisierte Fotosessions, Zwangsabtreibungen oder der Konsum von Kinderpornografie: Ein am Freitag veröffentlichter Untersuchungsbericht zeigt das Ausmass des Missbrauchsskandals in der Abtei St-Maurice auf. Über Jahrzehnte kam es im ältesten Kloster der Schweiz zu Übergriffen, hauptsächlich an Minderjährigen.
2023 hatte das Westschweizer Fernsehen RTS erstmals Missbrauchsvorwürfe publik gemacht. Die Abtei liess daraufhin eine unabhängige Untersuchung durch die Universität Freiburg durchführen. Auch die Walliser Regierung reagierte und verstaatlichte das bis dahin an das Kloster angeschlossene Gymnasium.

Der 164-seitige Bericht wirft ein rabenschwarzes Licht auf die Abtei und die katholische Kirche. Gestützt auf Zeugenaussagen und Unterlagen des Klosterarchivs sind 67 Vorfälle dokumentiert, die sich zwischen 1960 und 2024 ereignet haben - die meisten zwischen 1990 und 2010. Begangen wurden sie von 30 Chorherren. Wobei von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen wird. Nur in Einzelfällen kam es zu Strafverfahren.
Die Verantwortlichen der Abtei haben die Augen verschlossen. Meldungen wurden nicht ernst genommen, weil man um den Ruf der Institution fürchtete. Beschuldigte Chorherren wurden versetzt oder deren Taten vertuscht.
Die Abtei zeigt sich in einer Stellungnahme «zutiefst erschüttert» über die Erkenntnisse. Die Rede ist von einer «Kultur des Schweigens und der Banalisierung», die geherrscht habe. Man anerkenne die Fehler vollumfänglich an.
Die Empfehlungen der Wissenschaftler sind fast schon erschreckend trivial: Die Abtei müsse Meldungen ernst nehmen, dürfe sexuelle Gewalt in den Akten nicht mit Worten wie «eine Dummheit» beschönigen, heisst es beispielsweise im Bericht.
Die Abtei hat am Freitag einen Aktionsplan präsentiert, der diese Empfehlungen aufgreift. Eine Kommission soll die Umsetzung überwachen. (lha)
13:00 Uhr
Freitag, 20. Juni
Ohne Gegenstimme: Parlament spricht fünf Millionen Soforthilfe für Blatten
Die Hilfe für das vom Felssturz verschütteten Blatten war unbestritten: Ohne Gegenstimmen ging das Bundesgesetz für Soforthilfe für Blatten am Freitagmorgen durch die Schlussabstimmung. Das Gesetz regelt, wie fünf Millionen Franken an die Betroffenen des verschütteten Dorfes ausbezahlt werden sollen.
Am Samstag will Nationalratspräsidentin Maja Riniker das Lötschental besuchen und sich ein Bild vor Ort machen. (wan)
08:11 Uhr
Freitag, 20. juni
Vater Hurni auf Platz – Parlament sagt Ja zur Individualbesteuerung
Die Schlussabstimmung im Ständerat war mit Spannung erwartet worden, denn bei einem Nein wäre die Individualbesteuerung vom Tisch. Und im Voraus war gewiss: Es wird ein knappes Ergebnis werden. Erstens, weil ein Schaffhauser Ständeratssitz vakant ist, nachdem die Wahl des SP-Mannes Simon Stocker als ungültig erklärt wurde. Zudem, weil das Pro-Lager für die Individualbesteuerung bangte, dass der Neuenburger Sozialdemokrat Baptiste Hurni just am Freitagmorgen Vater würde und sich zur Unterstützung seiner Partnerin im Kreisssaal befinden würde.

Nun, Hurni war da und erhielt zu Sitzungsbeginn den Glückwunsch zur Geburt seines Kindes sowie einen warmen Applaus der Kolleginnen und Kollegen. Als sodann der Rat zur Abstimmung schritt, zeigte sich, dass Hurnis Stimme nicht unbedingt nötig gewesen wäre: Der Ständerat sagte mit 22 zu 21 Stimmen Ja zum Gesetz über die Individualbesteuerung. Hätte es - ohne Hurni - ein Patt gegeben, wäre Ständeratspräsident Andrea Caroni mit dem Stichentscheid zum Zug gekommen - und der ist ein klarer Befürworter der Individualbesteuerung.
Auch im Nationalrat fand die Vorlage eine Mehrheit - allerdings haben Mitte, SVP und der Bauernverband bereits das Referendum gegen die Vorlage angekündigt. Auch ein Kantonsreferendum ist weiterhin möglich - dabei müssten sich acht oder mehr Kantone gegen das neue Gesetz stellen. (sbü./mg)
17:54 Uhr
Mittwoch, 18. Juni
Westschweizer Kantone verbannen Smartphones aus Schule
In der Romandie und im Tessin bleibt das Smartphone in der Schule zukünftig ausgeschaltet. Wie die Konferenz der Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren der Romandie und des Tessins (CIIP) am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, habe man sich auf eine gemeinsame Regelung geeinigt.

Die Entscheidung sei eine Reaktion auf wachsende Sorgen über die psychische Gesundheit der Schüler und die problematische Bildschirmnutzung, vor allem mit Bezug auf soziale Medien, schreibt die Konferenz. Das Smartphone-Verbot gelte nicht nur während des Unterrichts, sondern auch in den Pausen.
Man strebe kein Technologieverbot an, sondern wolle das Smartphone in «einer strukturierten, reflektierten und den Lernzielen angepassten Weise» zulassen. Weiterhin eingesetzt werden solle es im Rahmen des IT-Unterrichts, von Präventionsprojekten (etwa vor sexueller Belästigung oder Desinformation) oder bei von Lehrkräften betreute Bildungsprojekten.
Schon bisher verbot die Mehrheit der lateinischen Kantone das Smartphone in der Schule grundsätzlich. Für die Umsetzung der neuen einheitlichen Regelung sind die einzelnen Kantone zuständig. Sie sollen per Anfang des neuen Schuljahrs 2025/26 eingeführt werden. Die CIIP empfiehlt, diesen Prozess durch einen «konstruktiven Dialog» mit den Schülern, deren Familien sowie den Lehrkräften zu verbinden. (cbe)
17:30 Uhr
Montag, 16. Juni
Neue Absturzgefahr: Brienz darf vorerst nicht betreten werden

Die Bevölkerung der Bündner Gemeinde Brienz kann das Dorf seit Donnerstagnachmittag nicht mehr betreten. Denn der kritische Teil des Berges oberhalb der Gemeinde, das sogenannte «Plateau» rutscht schneller als bis anhin. Gemäss dem zuständigen Gemeindeführungsstab Albula hat sich dieses «Plateau» so stark beschleunigt, dass es nun abzustürzen droht. Welche Gebiete von einem Absturz genau gefährdet sind, lässt sich laut Gemeinde noch nicht sagen.
Darum ist der Zutritt aktuell für alle verboten - auch für die Bauern, welche die Wiesen rund um das Dorf bewirtschaften. Auf Anweisung des Gemeindeführungsstabs haben die Landwirte bereits am Sonntag ihre Tiere von den Weiden geholt. Ob und wie schnell sich die Situation verschärft, beobachten die Behörden genau - und werden informieren, sobald die Gefährdung besser eingeschätzt werden kann.
Klar ist: Das neuerliche Betretungsverbot ist eine weitere Zäsur im Alltag der Bevölkerung, die das Dorf tagsüber wieder besuchen durfte. Allerdings haben die Behörden die Hoffnung bereits zerschlagen, dass sich die Lage mittelfristig stabilisieren wird. Die Gemeinde hat darum bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die teilweise oder gesamte Umsiedlung des Dorfes unterstützen soll. (wan)
14:11 Uhr
Donnerstag, 12. Juni
Regionalverkehr ist pünktlicher und sauberer unterwegs
Die Zufriedenheit mit dem öffentlichen Regionalverkehr in der Schweiz ist weiterhin gross. Dies teilte das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Donnerstag mit. Es stützt sich dabei auf die Auswertung der von 60 teilzeitlich angestellten Testkundinnen und Testkunden erhobenen Daten.
Diese erfassten im vergangenen Jahr bei schweizweit 64 Transportunternehmen insgesamt fast 100’000 Bewertungen in Fahrzeugen und an Haltestellen. Sie bewerteten dabei Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Funktionsfähigkeit, Kundeninformation und das Verhalten des Personals.

Fast 95 Prozent der Züge und 90 Prozent der Busse kamen gemäss BAV pünktlich an. Verbessern gegenüber dem Vorjahr konnten sich S-Bahnen sowie Busse und Regionalzüge in ländlichen Gebieten. Weniger pünktlich verkehrten hingegen die RegioExpress-Züge und Busse in den Agglomerationen.
Der Zustand in den Zügen und Büssen wurde in allen Regionen der Schweiz besser bewertet als im Vorjahr. Insbesondere bei der Sauberkeit wurden gegenüber 2023 bei allen Indikatoren Fortschritte erzielt - mit Ausnahme der Toiletten. (cbe)
15:18 Uhr
Mittwoch, 11. Juni
Wegen hoher Rohstoffgewinne: Kanton Genf zahlt beim Finanzausgleich am meisten

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ausgleichszahlen der Kantone für das Jahr 2026 um 227 Millionen Franken an. Insgesamt werden 6,4 Milliarden Franken umverteilt, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung mitteilt. Zwei Drittel davon trägt der Bund, einen Drittel die Kantone.
Grund für diesen Anstieg der Ausgleichszahlungen sei das starke Wachstum des Ressourcenausgleichs. Weil sowohl die Steuereinnahmen als auch die Unterschiede zwischen den Kantonen zugenommen haben, muss nun mehr ausgeglichen werden.
Besonders an Ressourcen gewonnen haben die Kantone Genf, Zug und Schaffhausen. Der starke Anstieg in Genf sei hauptsächlich auf aussergewöhnlich hohe Gewinne der Energie- und Rohstoffhandelsfirmen ab 2022 zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung. Damit wird der Kanton Genf neu vor Zürich und Zug zum grössten Beitragszahler. Die Berechnungen werden den Kantonen zur Stellungnahme unterbreitet. (leh)
17:28 Uhr
Dienstag, 10. Juni
Kantone proben den Aufstand gegen die Individualbesteuerung
Künftig sollen Ehepaare zwei Steuererklärungen ausfüllen: Das Parlament will die Individualbesteuerung einführen. Damit soll die steuerliche Heiratsstrafe abgeschafft und Erwerbsanreize für Frauen geschaffen werden. Hinter der Reform stehen FDP, GLP, SP und Grüne. Widerstand kommt von Mitte und SVP – und von den Kantonen.
Die Konferenz der Finanzdirektoren empfiehlt das Kantonsreferendum gegen die Individualbesteuerung. Damit das zustande kommt, braucht es das Veto von acht Kantonen. Und die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass dieses Quorum erreicht wird. Die Finanzdirektoren fürchten den Aufwand durch den Systemwechsel und mögliche Steuerausfälle. Auch sie wollen die Heiratsstrafe abschaffen, finden jedoch, der Bund soll sich den Kantonen anpassen.
Die Kantone haben erste einmal das Referendum ergriffen: 2004 gegen ein Steuerpaket. Sie waren erfolgreich. (dk)
16:47 Uhr
Dienstag, 10. Juni
Aussenminister Cassis reist nach Israel
Ignazio Cassis (FDP) besucht heute und morgen Israel und die Palästinenser Gebiete. Wie das Aussendepartement am Montag mitteilte, trifft sich der Bundesrat in Ramallah mit Mohammad Mustafa, dem Premierminister und Aussenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde. In Israel führt Cassis ein Gespräch mit Aussenminister Gideon Sa'ar. Im Zentrum der Treffen wird insbesondere die Situation im Gazastreifen sein. Die Schweiz rufe mit Nachdruck alle Parteien auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und sich ernsthaft und konstruktiv für eine diplomatische Lösung einzusetzen, heisst es in der Mitteilung. Der Bundesrat verlangt einen Waffenstillstand und dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen uneingeschränkten Zugang zu humanitärer Hilfe erhält. Die Landesregierung fordert zudem, dass die Hamas bedingungslos alle Geiseln freilässt. (kä)
09:59 Uhr
Dienstag, 10. Juni
Aline Trede will Berner Regierungsrätin werden

Sie ist seit fünf Jahren Chefin der Bundeshausfraktion der grünen Partei. Jetzt peilt Aline Trede den nächsten Karriereschritt an. Die Nationalrätin will in den Berner Regierungsrat. Die 41-jährige Mutter zweier Teenager gilt als Favoritin für die parteiinterne Ausmarchung. An der kantonalen Delegiertenversammlung vom 27. August werden die Grünen ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin bestimmen. Die nächsten Berner Kantonswahlen finden am 29. März 2026 statt.
Trede will die Nachfolge von der grünen Regierungsrätin Christine Häsler antreten. Für deren Nachfolge gibt es bereits mehrere Interessenten. (kä)
09:45 Uhr
Dienstag, 10. Juni
Pro-Palästina-Demonstranten besetzen Gleis
Am Montagabend haben an den Bahnhöfen in Lausanne und Genf Hunderte Menschen gegen die Situation im Gazastreifen protestiert. Die Pro-Palästina-Demonstranten besetzten das Gleis und legten für längere Zeit dem gesamten Zugverkehr lahm. Wie die SBB mitteilten, mussten Zugreisende am Dienstagmorgen Einschränkungen in Kauf nehmen. Es waren weniger Züge verfügbar, weil einige Zugkombinationen am Vorabend nicht ins Depot gebracht werden konnten. (kä)
09:17 Uhr
Dienstag, 10. Juni
Opferhilfe zahlt 6,5 Millionen Franken Entschädigung
Opfer von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt haben im letzten Jahr 6,5 Millionen Franken Entschädigung und Genugtuung durch die Kantone erhalten. Das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt führten die Opferhilfestellen im vergangenen Jahr 51'547 Beratungen durch. Das sind so viele wie noch nie, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.
Fast drei Viertel der Opfer waren Frauen, und etwas weniger als die Hälfte hat den Schweizer Pass. In 71 Prozent der registrierten Fällen gaben die Opfer an, den mutmasslichen Täter oder die mutmassliche Täterin zu kennen. In knapp vier von zehn Fällen der Beratungen handelte es sich um den Partner oder Ex-Partner des Opfers. (kä)
12:00 Uhr
Donnerstag, 6. Juni
Nationalrat sagt Nein zu Munitions-Milliarde
Mitte-links hat sich durchgesetzt: Der Nationalrat lehnt es ab, eine zusätzliche Milliarde Franken für den Kauf von Munition für die Fliegerabwehr zu sprechen. Mit 97 zu 77 Stimmen bei 19 Enthaltungen hat der Rat den Plänen der Sicherheitskommission eine Abfuhr erteilt.

Der Nationalrat hat im Rahmen der Beratungen über die Armeebotschaft 2025 über den zusätzlichen Verpflichtungskredit debattiert. Bereits im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass die Zusatzmilliarde auf der Kippe steht. Nicht nur SP, Grüne und GLP sind dagegen, sondern auch die Finanzkommission. Sie hatte Vorbehalte, weil völlig offen gewesen wäre, wie woher das Geld kommen soll. Wie CH Media berichtete, hatte die Armee bis zum Schluss für die Milliarde lobbyiert. Vergebens.
Deutlich Ja sagt der Nationalrat zur Armeebotschaft in der ursprünglichen Dimension. Sie sieht Verpflichtungskredite in der Höhe von knapp 1,7 Milliarden Franken vor, beispielsweise für den Kauf von Mini-Drohnen oder den Bau neuer Truppenunterkünfte. Auch der Ausmusterung der F-5-Tiger, mit denen die Patrouille Suisse heute fliegt, stimmt der Nationalrat zu.
13:30 Uhr
Dienstag, 4. Juni
Neubeurteilung von IV-Gutachten möglich
Personen, deren Antrag auf eine IV-Rente oder auf berufliche Massnahmen aufgrund eines IV-Gutachtens abgelehnt wurde, können heute keine Neubeurteilung verlangen. Selbst dann nicht, wenn das Gutachten nachweislich mangelhaft war. Das soll sich nun ändern. Nach dem Nationalrat hat nun auch der Ständerat eine entsprechende Forderung gutgeheissen.

Konkret soll ein IV-Anspruch künftig fair beurteilt werden können. Das bedeutet: Betroffene sollen einen abgelehnten IV-Entscheid, der aufgrund eines zweifelhaften Gutachtens entstand, anfechten können. Die IV-Stelle muss anschliessend den Anspruch auf IV-Leistungen erneut prüfen und Rentenleistungen gegebenenfalls rückwirkend zusprechen. (wan)
15:54 Uhr
Dienstag, 3. Juni
Bericht entkräftet Vorwürfe gegen Mitte-Generalsekretärin
Die Vorwürfe kamen im Januar 2023 auf. Zuerst via Anwaltskanzlei und dann auch via Medien erhoben sechs ehemalige Mitarbeitende des Generalsekretariats der Partei Die Mitte schwere Vorwürfe gegen Generalsekretärin Gianna Luzio. Unter ihr herrsche ein «Klima der Angst». Die Kritik an Luzio verstummte nie ganz und kochte im letzten Dezember parteiintern wieder hoch. Im Januar verteidigte Mitte-Präsident Gerhard Pfister seine rechte Hand im Gespräch mit CH Media: «Nachweislich falsche Gerüchte sowie persönlichkeitsverletzende Unwahrheiten gegen Gianna Luzio werden seit Jahren systematisch anonym gestreut.»

Pfisters Standpunkt wird jetzt gestützt durch Heinz Aemisegger. Der alt Bundesrichter untersuchte im Auftrag der Partei das Arbeitsumfeld im Generalsekretariat und kam in einem Bericht zum Schluss, dass keine Anhaltspunkte für persönliche Verfehlungen oder gar systematisches Fehlverhalten durch Luzio bestehe. Sie führe das Generalsekretariat kompetent, korrekt und professionell. Die Vorwürfe seien unbewiesen und unsubstantiiert. Zudem seien die Mitarbeitenden, welche Luzio kritisierten und teilweise seit mehr als fünf Jahren nicht mehr für die Mitte arbeiteten, nicht zu Gesprächen bereit gewesen.
Pfister tritt Ende Juni als Parteipräsident zurück. Einziger Nachfolgekandidat ist Philipp Bregy. Luzio wird noch solange im Generalsekretariat bleiben, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist. (kä)
12:00 Uhr
Dienstag, 3. Juni
Das Gesetz zur Einführung der Individualbesteuerung steht
Es ist ein Geschäft, das stets auf Messers Schneide steht: Die Einführung der Individualbesteuerung. FDP, SP, Grüne und GLP sind dafür und haben einen Kompromiss geschmiedet, an dem kein Deut mehr geändert werden darf. Die Steuerausfälle für den Bund dürfen maximal 600 Millionen Franken betragen und keinen Rappen mehr - sonst steigt die Linke aus und der Vorlage droht die Bruchlandung.
Mitte und SVP sind gegen die Reform, weil sie Ehepaare weiterhin gemeinsam besteuern wollen. Sie kritisieren, dass Familien mit einer traditionellen Rollenteilung durch das neue Modell stärker besteuert werden sollen. Die grössten Profiteure der Reform sind Ehepaare, die sich die Erwerbs- und Betreuungsarbeit gleichmässig aufteilen. Nebst der Abschaffung der steuerlichen Heiratsstrafe ist es denn auch ein Ziel der Reform, die Erwerbsanreize für Frauen zu steigern. Wegen der Progression wird das Zweiteinkommen heute sehr stark besteuert.
Die beiden Lager halten sich im Parlament in etwa die Waage. Das führt dazu, dass jede Stimme zählt - und dass es im Lager der Befürworter, das leicht im Vorteil ist, keine Abweichler geben darf. Zudem darf beim nationalrätlichen Kompromiss eben nichts mehr geändert werden.
Die FDP schliesst die Reihen
Der Ständerat wollte ursprünglich die negativen Folgen für Einverdienerpaare abschwächen. Die vorberatende Kommission etwa wollte ermöglichen, dass der Kinderabzug von 10'700 Franken auf die Ehepaare aufgeteilt werden kann. Damit würde verhindert, dass der Abzug beim Ehepartner mit einem tiefen Einkommen ins Leere fällt, also keine Wirkung entfalten kann. In der Kommission stimmte FDP-Ständerat Martin Schmid noch für dieses Vorgehen und mit SVP und Mitte. Im Rat jedoch schloss die FDP die Reihen. Der Kinderabzug darf nicht übertragen werden, dafür beträgt er 12'000 Franken.
Das heisst: Der Ständerat schloss sich dem Kompromiss des Nationalrates an. Das Gesetz für die Einführung der Individualbesteuerung steht. Allerdings: beide Räte müssen dem Gesetz auch noch in der Schlussabstimmung zustimmen. Auch dann kommt es nochmals auf jede Stimme an.
Zudem: Ein Referendum gegen die Individualbesteuerung und damit eine Volksabstimmung ist wahrscheinlich. Die Mitte-Partei will es ergreifen, wie Fraktionschef Philipp Bregy sagt. Offiziell fällen muss der Entscheid die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonalparteien, die Parteileitung wird das Referendum beantragen.
Würden die Stimmberechtigten das Gesetz ablehnen, wäre das Thema aber nicht vom Tisch. Dann würden die FDP Frauen ihre Initiative zur Einführung der Individualbesteuerung zur Abstimmung bringen. Und auch die Mitte-Initiative zur Abschaffung der steuerlichen Heiratsstrafe ist noch auf der politischen Agenda. Die Mitte will die Heiratsstrafe zwar ebenfalls abschaffen, aber eben so, dass Ehepaare auch weiterhin gemeinsam besteuert werden.
Im Vordergrund steht die so genannte alternative Steuerberechnung. Das heisst, die Steuerämter sollen für jedes Ehepaar die Steuern zweimal berechnen: einmal als Ehepaar und einmal als Einzelpersonen. Das Paar bezahlt dann den tieferen Betrag. Der Bund schätzt die Mindereinnahmen grob auf 700 Millionen bis 1,4 Milliarden Franken pro Jahr. Beim tieferen Betrag würden Konkubinatspaare mit Kindern deutlich stärker zur Kasse gebeten als heute, weil sie den Verheiratetentarif nicht mehr geltend machend dürften. (dk)
11:32 Uhr
Dienstag, 3. Juni
Parlament will keine «Lex Uber»
Der Nationalrat will derzeit keine Änderungen am Selbstständigenstatus im Arbeitsrecht. Am Dienstag erlitt eine Vorlage von Jürg Grossen (GLP/BE) Schiffbruch. Diese hatte gefordert, dass bei der Beurteilung, ob die Person nun selbstständig arbeite oder nicht, der Parteiwille höher gewichtet wird. Konkret sollte es leichter werden, sich als Selbstständiger zu deklarieren.
Das hätte vor allem der sogenannten Plattform-Wirtschaft geholfen. Heute stellen sich Plattformen wie der Fahrdienst Uber auf den Standpunkt, dass die Fahrerinnen und Fahrer keine Angestellten seien und die App lediglich als Vermittler diene. Dementsprechend müssten sie auch nicht Sozialleistungen bezahlen, das sei Sache der Fahrer. Bereits mehrfach haben Gerichte den Fahrdienst hier zurückgepfiffen.
Mit dem Vorstoss von Grossen wären viele solcher Modelle legalisiert worden. In der Kommission hatte er noch eine knappe Mehrheit gefunden. Im Rat versenkten Grüne, SP und Mitte die Vorlage. Es sei störend, «dass internationale Tech-Konzerne bessergestellt werden als Schweizer KMU», sagte SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer. Die bestehenden Regeln hätten sich bewährt, fand auch Thomas Rechtsteiner (Mitte/AI). Auch der Bundesrat hatte sich dagegengestellt.
Die FDP stellte sich dagegen auf de Standpunkt, dass heute rund 4000 Personen pro Jahr gegen ihren Willen nicht als Selbstständige anerkannt werden. «Es sind Menschen, die unabhängig arbeiten wollen und deren Willen in der heutigen Praxis nicht angemessen berücksichtigt wird», sagte Andri Silberschmidt (ZH). Kritiker der Vorlage bemängeln, dass viele Leute von den Unternehmen dazu gedrängt werden, sich als Selbstständige zu deklarieren. «Mein Menschenbild geht davon aus, dass erwachsene Menschen prinzipiell urteilsfähig sind und auch entsprechende Entscheide treffen können», entgegnete Silberschmidt.
Am Ende stimmten 93 Nationalräte und Nationalrätinnen gegen die Neuregelung und 88 dafür. Die Vorlage ist damit gescheitert. (mg)
17:59 Uhr
Montag, 2. Juni
Vreni Spoerry ist im Alter von 87 Jahren gestorben

Die national bekannte Zürcher FDP-Politikerin Vreni Spoerry ist am 29. Mai gestorben, wie der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bestätigt. Spoerry sass von 1983 bis 1996 im Nationalrat. Ab März 1996 bis November 2003 vertrat sie den Kanton Zürich im Ständerat. Die Wirtschaftsvertreterin galt als äusserst einflussreich und profilierte sich insbesondere als Finanzpolitikerin. Eine entscheidende Rolle spielte sie bei der Einführung der Mehrwertsteuer.
Die Zürcherin galt als stramme Vertreterin des Wirtschaftsfreisinns und nahm in Verwaltungsräten der wichtigsten Schweizer Unternehmen Einsitz: angefangen bei der Schweizerischen Kreditanstalt, der späteren CS, über Nestlé bis zur Swissair. (sbü)
Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie hier.
15:02 Uhr
Montag, 2. Juni
Zoll-Deal mit Trump: Aussenpolitisch Kommission gibt grünes Licht, aber ...

Noch vor Beginn der Sommersession hat die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK-N) am Montagmorgen über die anstehenden Verhandlungen im Zollstreit mit den USA diskutiert. Sie sagte mit 17 gegen 8 Simmen Ja zum Verhandlungsmandat, das der Bundesrat letzte Woche verabschiedet hat. Die APK-N unterstütze die Zielsetzung, die Beziehungen zu den USA zu stärken und in der Frage der Zölle rasch Lösungen mit den USA zu finden, sagte Kommissionspräsident Laurent Wehrli (FDP) an einem Point de Presse. Dass die APK-N bereits heute tage, zeige, dass sie den Prozess des Bundesrats nicht bremsen wolle, erklärte Wehrli.
Allerdings stellt die APK-N auch Bedingungen. So müsse das Verhandlungsergebnis kompatibel sein mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen des Bunds, so jenen zur Welthandelsorganisation WTO, zu den bilateralen Verträgen mit der EU und zu den Freihandelsabkommen. Auch dürfe der Deal mit den USA das mit Brüssel ausgehandelte Stabilisierungspaket, die sogenannten Bilateralen III, nicht gefährden.
Es gab mehrere Anträge, etwa auf eine vertieftere Analyse, wie die US-Verhandlungen mit der EU zu koordinieren wären. Oder, dass das Ergebnis der Verhandlungen in Form eines referendumsfähigen Bundesbeschlusses . vorgelegt werden solle. Doch die Vorschläge wurden alle verworfen, wie Kommissionsvizepräsidentin Sibel Arslan sagte.
Später am Nachmittag nahm auch die Aussenpolitische Kommission des Ständerats die Diskussion über das Dossier auf. Sie kam aber innert der vorgesehen Frist von 45 Minuten zu keinem Entscheid und wollte die Sitzung gegen Abend fortführen. (sbü.)
11:07 Uhr
Montag, 2. Juni
Moutier wird jurassisch: Weitere Übergangsmassnahmen
Die Vorbereitungen für den Wechsel der Gemeinde Moutier zum Kanton Jura schreiten voran. Der Regierungsrat des Kantons Bern und die Regierung des Kantons Jura haben im Hinblick auf den Kantonswechsel von Moutier sieben neue Vollzugsvereinbarungen verabschiedet. Das teilen die beiden Kantone am Montag mit.
Die Bestimmungen ergänzen das von den beiden Kantonen verabschiedete Moutier-Konkordat und sollen für die Bevölkerung einen reibungslosen Übergang gewährleisten.
Die Regierungen der Kantone wollen in den kommenden Monaten weitere Vollzugsvereinbarungen treffen. Der Kantonswechsel von Moutier erfolgt per 1. Januar 2026. (pin)
09:56 Uhr
Montag, 2. Juni
Sust-Untersuchungsbericht zum Gotthard-Unfall
Vor knapp zwei Jahren entgleiste ein Güterzug im Gotthard-Basistunnel. Nun haben die zuständigen Behörden den Unfall aufgearbeitet. Ihr Bericht zeigt: Das Problem besteht weiter. Die SBB warnen eindringlich vor Untätigkeit.
13:45 Uhr
Mittwoch, 28. Mai
Mehr Ukraine-Flüchtlinge sollen einen Job haben
Personen, die aus der Ukraine geflohen sind, sollen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Der Bundesrat erneuert seine ehrgeizigen Ziele: Bis Ende des Jahres sollen 50 Prozent aller Menschen mit Schutzstatus S, die seit mindestens drei Jahren in der Schweiz sind, einen Job haben.
Und das obwohl der Bund nicht mal seine bisherigen Ziele erreichen konnte: Ursprünglich war angepeilt worden. dass per Ende 2024 mindestens 40 Prozent aller Ukraine-Flüchtlinge im Arbeitsleben sind. Per Ende April waren es gerade einmal 32 Prozent.
Damit das künftig besser wird, nimmt der Bundesrat die Kantone in die Pflicht. Kantone, welche dieses Ziel nicht erreichen, müssen in Zukunft zusätzliche Massnahmen umsetzen. Erreicht ein Kanton die Erwerbsquote nicht, muss er einen Plan erarbeiten und umsetzten. Genüge auch das nicht, werde das System der Integrationsförderung extern untersucht.
Auf härtere Mittel verzichtet der Bundesrat. In der Vernehmlassung hatte der Bund auch finanzielle Konsequenzen angedroht. Mit einem sogenannten Malus-System hätten hinterherhinkende Kantone weniger Geld vom Bund für die Integrationsförderung erhalten. Auf diese Massnahme verzichtet der Bund aber nach heftigem Widerstand der Kantone. (mg)
13:31 Uhr
Mittwoch, 28. Mai
Ruag kann Panzer doch nach Deutschland verkaufen
Die Ruag darf doch Panzer nach Deutschland verkaufen. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch bewilligt, dass 71 Kampfpanzer Leopard 1 A5 «bewilligungsfrei» an unseren nördlichen Nachbar weitergeben darf. Die Panzer befinden sich derzeit in Italien. Dort befinden sich insgesamt sogar 96 solcher Panzer, bei 25 davon seien die Eigentumsverhältnisse «noch strittig», wie es in der Mitteilung heisst.
Noch 2023 hatte die Regierung das gleiche Geschäft gestoppt. Damals waren die Panzer für die Weitergabe an die Ukraine vorgesehen. Das gehe aufgrund der Neutralität der Schweiz nicht, befand der Bundesrat. Nun ist vertraglich abgemacht, dass die Panzer nicht an die Ukraine gehen dürfen. (mg)
14:18 Uhr
Sonntag, 25. Mai
Friedenspolitik: Keller-Sutter telefoniert mit Präsident Macron
Karin Keller-Sutter hat am Samstagvormittag ein Telefonat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geführt. Auf der Plattform X schrieb die Bundespräsidentin dazu: «Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die aktuelle geopolitische Lage sowie das bilaterale Verhältnis.» Das legt nahe, dass Keller-Sutter die Bemühungen der Schweiz um Friedensgespräche zur Ukraine fortführt.
Wie dieses Portal am Mittwoch meldete, war Keller-Sutter zuletzt persönlich in hochrangige Gespräche involviert. Anlässlich des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft im albanischen Tirana Mitte Mai sowie der Amtseinsetzung von Papst Leo XIV. sprach sie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Dieser nannte die Schweiz darauf öffentlich als möglichen Ort für Friedensgespräche mit Russland.
Kontakte hatte Keller-Sutter auch mit dem US-Aussenminister Marco Rubio sowie mehreren Staats- und Regierungschefs aus Europa. Zudem hat die Ukraine die Schweiz angefragt, ein Schutzmachtmandat gegenüber Russland anzunehmen. Als nächstes wird Botschafter Gabriel Lüchinger, Sicherheitsberater des Bundesrats, an einer Sicherheitskonferenz teilnehmen, die von Dienstag bis Donnerstag in Moskau stattfindet. Dies als wohl einziger Vertreter aus Westeuropa. (sbü.)
16:45 Uhr
Freitag, 23. Mai
Affäre Valérie Dittli: Staatsanwalt leitet Strafuntersuchungen ein
In der Affäre um die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli eröffnet der Generalstaatsanwalt zwei Strafuntersuchtungen. Diese sollen zeigen, ob unter der Führung der Mitte-Politikerin im Finanzdepartement Straftaten begangen worden sind. Das berichtete das Westschweizer Portal «24 heures» am Freitag. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte gegenüber der Zeitung, dass Anhörungen im Gange seien, doch habe noch keine Person «den Status eines Beschuldigten».

Die Dittli-Affäre erschüttert den Kanton seit mehreren Monaten und zieht immer weitere Kreise - zuletzt kam auch FDP-Ständerat Pascal Broulis unter Druck. Eine Untersuchung des ehemaligen Neuenburger Staatsrats Jean Studer befasste sich mit mutmasslichen Missständen im Steueramt des Kantons Waadt.
In seinem Bericht, der im März publik wurde, wirft Studer Valérie Dittli zwei Rechtswidrigkeiten vor: Sie soll das Amtsgeheimnis verletzt oder eine andere Person dazu angestiftet haben. Und sie soll die Annullierung ausgestellter Steuerveranlagungen von Top-Steuerzahlenden verlangt haben. Aufgrund des Berichts entzog das Regierungskollegium der 32-jährigen, aus dem Kanton Zug stammenden Magistratin die Finanzen. Und es leitete den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter. Die Generaldirektorin für Steuern, die sich in einem persönlichen Konflikt mit Dittli befand, wird ihrerseits demnächst in den Vorruhestand gehen.
Laut der Staatsanwaltschaft werden die beiden Ermittlungen getrennt geführt. Sie sollen zeigen, ob tatsächlich Straftaten begangen wurden und gegebenenfalls, wer diese begangen hat. (sbü.)
14:19 Uhr
Freitag, 23. Mai
Dem NDB läuft weiterhin das Kader davon
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) muss eine neue Leitung für seine Personalabteilung suchen. Wie der NDB auf Anfrage bestätigt, ist die Spitze der HR-Services aufgrund eines Abgangs vakant. Ebenfalls ausgeschrieben ist die Stelle eines «Intelligence Officer International». Zu dessen Aufgaben gehört es, alle Kontakte des NDB mit seinen ausländischen Partnerdiensten zu koordinieren. Zu den Gründen für diese Vakanz schweigt der NDB.
Im April hatte CH Media berichtet, dass die Leitung des Rechtsdienst im NDB zum zweiten mal innert kurzer Zeit vakant ist. Der Nachrichtendienst befindet sich schon seit längerem in der Krise. Ein gross angelegter Transformationsprozess sorgt seit Jahren für steigende Unzufriedenheit beim Personal. Die Kantonspolizeien geben den Leistungen des Dienstes ungenügende Noten. Und NDB-Direktor Christian Dussey hat Ende Februar angekündigt, seinen Posten per Ende März 2026 zu verlassen. (cbe)
13:29 Uhr
Freitag, 23. Mai
Zollstreit mit Trump: Vorverhandlungen dauern länger als erwartet

Die Schweiz solle nach Grossbritannien eines der nächsten Länder sein, mit denen die USA eine Grundsatzerklärung zur Beilegung des Zollstreits abschliessen werden. «Am liebsten das zweite», sagte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am 9. Mai, nachdem sie in Genf den amerikanischen Finanzminister Scott Bessent getroffen hatte. Und sie kündete an, dass eine Absichtserklärung innert ein bis zwei Wochen finalisiert werden könnte. Bessent erwartete diese Absichtserklärung sogar innert einer Woche.
Nach Ablauf der zwei Wochen zeigt sich nun, dass diese Frist nicht eingehalten werden konnte. Auf Anfrage schreibt die Bundeskanzlei, die Gespräche nähmen «etwas mehr Zeit in Anspruch, als beide Seiten vor zwei Wochen angenommen haben». Gründe dafür nennt die Bundeskanzlei nicht.
Sie verweist aber auf die Erklärung nach der Bundesratssitzung vom 14. Mai. Damals wurden das Finanz- und das Wirtschaftsdepartement beauftragt, die Gespräche mit den USA weiterzuführen und einen baldigen Abschluss einer «unverbindlichen Absichtserklärung» anzustreben. Es handle sich hierbei nicht um formelle Verhandlungen. «Ziel der Gespräche ist insbesondere die dauerhafte Aufhebung der am 2. April 2025 eingeführten ‹reziproken› Zusatzzölle wie auch anderer Zusatzzölle», schreibt die Bundeskanzlei. (sbü.)
13:33 Uhr
Mittwoch, 21. Mai
Im September wird über Eigenmietwert und E-ID abgestimmt
An seiner Sitzung vom Mittwoch hat der Bundesrat die Abstimmungsvorlagen für den 28. September festgelegt. An die Urne kommt die Einführung einer Objektsteuer, mit der die Abschaffung des Eigenmietwerts verknüpft ist, sowie das Bundesgesetz über die E-ID. Beide Vorlagen hat das Parlament in der Wintersession 2024 verabschiedet.
Da es sich bei der Vorlage rund um die Abschaffung des Eigenmietwerts um eine Verfassungsänderung handelt, ist eine Abstimmung obligatorisch. Neben dem Volksmehr muss dabei auch das Ständemehr erreicht werden. Gegen die Einführung der E-ID ist erfolgreich das Referendum ergriffen worden. Hier genügt ein Volksmehr, damit das Bundesgesetz in Kraft treten kann.
Wie der Bundesrat mitteilt, stehen bei der Volksabstimmung vom 28. September 2025 erstmals auch Stimmzettel mit rätoromanischer Abstimmungsfrage zur Verfügung. Dies geht auf ein Ersuchen der Bündner Regierung zurück. Künftig produziert der Bund dreisprachige Stimmzettel – Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch –, wie sie in Graubünden bereits bei kantonalen Abstimmungen verwendet werden. (cbe)
13:13 Uhr
Mittwoch, 21. Mai
Pflegende verärgert über Umsetzung ihrer Initiative
Nun geht es ums Eingemachte: Die Umsetzung der Pflegeinitiative geht in die heisse Phase. In der anstehenden zweiten Etappe sollen nämlich die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Nebst besseren Löhnen gehören planbare Einsätze, eine Reduktion der Wochenarbeitszeit sowie ein klar definierter Betreuungsschlüssel zu den Forderungen des Pflegepersonals. Weil sich die Politik nicht darauf einliess, reichte der Pflegeverband die Initiative ein – und erhielt in der Bevölkerung klare Unterstützung.

(27. 3. 2025))
Die erste Etappe war nämlich kaum umstritten: Die Schweiz soll mehr Pflegepersonal ausbilden, weil Fachkräfte fehlen. Denn der Bedarf nach Pflegeleistungen steigt in den nächsten Jahren. Über die besseren Arbeitsbedingungen soll in der zweiten Etappe sichergestellt werden, dass die Pflegenden auch im Beruf bleiben.
Der Bundesrat hat am Mittwoch ein neues Gesetz verabschiedet, welches die Arbeitsbedingungen in zehn Bereichen verbessern soll. Dazu gehört, dass Dienstpläne vier Wochen im Voraus erstellt werden und kurzfristige Änderungen finanziell oder zeitlich ausgeglichen werden müssen. Auch die Höchstarbeitszeit soll von 50 auf 45 Stunden pro Woche gesenkt und die Normalarbeitszeit zwischen 40 und 42 Stunden definiert werden, um die Gesundheit der Pflegenden zu schützen, wie der Bundesrat schreibt.
Überdies sollen Überstunden grundsätzlich durch Freizeit ausgeglichen werden – oder über einen Lohnzuschlag von mindestens 25 Prozent. Einsätze an Sonn- oder Feiertagen sollen auch mit Freizeit und einem Lohnzuschlag von mindestens 50 Prozent kompensiert werden.
Die Betroffenen und ihre Unterstützer sind von der Vorlage enttäuscht. Der Verband der Pflegefachleute (SBK) erklärt, die Umsetzung sei «ungenügend». Er kritisiert, dass «Regelungen für eine bedarfsgerechte Personalausstattung und für eine bessere Finanzierung der Pflege vollständig fehlen». SBK-Geschäftsführerin Yvonne Ribi sagt, es wäre eine Verschwendung öffentlicher Gelder, genügend Fachkräfte auszubilden, aber keine Massnahmen zu ergreifen, damit diese länger im Beruf bleiben.
Auch die beiden Parteien SP und Grüne, welche die Pflegeinitiative unterstützten, halten die Vorlage für «knauserig» und «verbesserungsfähig». In der parlamentarischen Beratung haben sie nun die Gelegenheit, Änderungen einzubringen. (wan)
17:49 Uhr
freitag, 16. mai
Europapolitik: Scharfe Kritik an der Mitte
In einem gemeinsamen Communiqué kritisieren SP, Grüne, GLP und FDP die Mitte-Partei scharf. Grund für den Ärger: Mitte- und SVP-Vertreter haben in der staatspolitischen Kommission des Nationalrats (SPK-N) gemeinsam für einen knappen Mehrheitsentscheid gesorgt. Mit 13 zu 12 Stimmen beschloss die Kommission, weitere Anhörungen zu einem möglichen direkten Gegenvorschlag zur 10-Millionen-Schweiz-Initiative der SVP durchzuführen, bevor sie diese Initiative materiell beraten will. Dies teilte die die SPK-N am Freitag mit.

SP, Grüne, GLP und FDP werfen der Mitte «unverständliche Verzögerungstaktik» vor. Es brauche eine möglichst baldige Abstimmung über die SVP-Initiative, um zu klären, ob man die Kündigung der bilateralen Verträge riskieren oder stabile, verlässliche Beziehungen zur EU wolle. Das Verhalten der Mitte-Vertreter in der Kommission verhindere eine Abstimmung über die SVP-Initiative Anfang 2026, schreiben die vier Parteien weiter.
Der Bundesrat hat sich gegen einen direkten Gegenvorschlag zur SVP-Initiative ausgesprochen. Eine Abstimmung über die verschiedenen Bestandteile des neuen Vertragspaket mit der EU wäre frühestens 2027 möglich. Realistischerweise dürfte dies jedoch im Fall, dass das Parlament den Verträgen zustimmt, erst 2028 passieren. (cbe)
17:48 Uhr
Freitag, 16. mai
Kurzarbeit soll verlängert werden
Die Sozialkommission des Ständerats will die Höchstbezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigung auf 24 Monate verlängern, um Entlassungen in der krisengeplagten Tech-Industrie zu vermeiden. Sie hat eine entsprechende Kommissionsinitiative deutlich angenommen und für dringlich erklärt. Als nächstes muss die Sozialkommission des Nationalrats darüber befinden.
Aktuell dürfen Unternehmen innerhalb einer Rahmenfrist von zwei Jahren während höchstens zwölf Monaten Kurzarbeitszeitenschädigung beziehen. Der Bundesrat kann diese Maximalbezugsdauer jedoch unter bestimmten Bedingungen vorübergehend auf bis zu 18 Monate verlängern. Diese Massnahme hat die Landesregierung im letzten Jahr ergriffen und jüngst bis Sommer 2026 verlängert. (cbe)
15:47 Uhr
Freitag, 16. Mai
Mehr als 1000 Zuschriften zur Verbesserung der Gesundheitspolitik
Am Donnerstag hat das Innendepartement einen elektronischen Briefkasten installiert und die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Empfehlungen zum Kostensparen im Gesundheitswesen einzuschicken. Das Interesse ist riesig. Etwas mehr als 24 Stunden später sind über 1000 Zuschriften eingegangen, wie das Departement angibt.
Inhaltlich lässt sich zu den Vorschlägen zwar noch nichts sagen. Doch alleine die schiere Anzahl der Zuschriften zeigt: Es besteht dringender Handlungsbedarf - und das Potenzial ist womöglich noch nicht ausgeschöpft. Das sieht auch die zuständige Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider so, die das Projekt ins Leben rief, um neue Ideen zu gewinnen. Sie sieht die Kostendämpfung als «Daueraufgabe». Für die Bevölkerung ist allerdings am 20. Juni wieder Schluss: Dann endet das Projekt des elektronischen Briefkastens. (wan)
17:16 Uhr
Donnerstag, 15. Mai
Bundesrat gegen offenen Gotthardpass im Winter
Der Gotthardpass erwacht aus der Winterpause: Ab heute ist die Passstrasse wieder für den Verkehr freigegeben. Doch soll sie künftig auch bei Schnee befahrbar sein? Der Bundesrat bleibt dabei: Nein. Er lehnt einen Vorstoss des Aargauer SVP-Nationalrats Benjamin Giezendanner ab, der genau dies fordert. Fast sechzig Nationalrätinnen und Nationalräte, die meisten aus SVP und FDP, hatten die Forderung mitunterzeichnet.

Rund 300 Millionen Franken würde es laut Schätzungen kosten, die Passstrasse auch im Winter befahrbar zu machen. Giezendanner findet das vergleichsweise wenig. Er argumentiert mit dem steigenden Verkehrsaufkommen im Tunnel. Mit der ganzjährigen Öffnung könnten zudem andere Alpenpässe entlastet werden – und die Verbindung zwischen Norden und Süden wäre immer gewährleistet.
Der Bundesrat indes gibt zu bedenken, dass es im Winter kaum zum Stau vor dem Gotthardtunnel kommt. Knackpunkt ist Ostern. Bereits heute versuche man, die Passstrasse so früh wie möglich zu öffnen. Das Fazit der Regierung: Die erforderlichen Investitionen für einen wintersicheren Betrieb übersteigen den Nutzen «deutlich».
Auch Urner Politiker haben sich bereits skeptisch zum Vorschlag Giezendanners geäussert. Sie befürchten, dass es an Winterwochenenden zum Verkehrschaos auf Kantonsstrassen kommen würde. (lha)
16:40 Uhr
Donnerstag, 15. Mai
Bundesrat lehnt Velovignette ab
Der Bundesrat spricht sich dagegen aus, für Velofahrerinnen und Velofahrer ab 12 Jahren eine kostenpflichtige Vignette einzuführen, wie er in einer Antwort auf einen Motion von Nationalrätin Nina Fehr Düsel (SVP/ZH) schreibt.

Düsel Fehr hatte vorgeschlagen, dass der Bundesrat prüft, eine kostenpflichtige Vignette in der Höhe von 20 Franken pro Jahr pro Velofahrenden ab 12 Jahren einzuführen. Damit sollten diese im Sinne des Verursacherprinzips und der Kostentransparenz einen bescheidenen Beitrag an die Verkehrsinfrastruktur leisten.
In seiner Antwort zeigt der Bundesrat zwar Verständnis für die Forderung. Allerdings bestünden viele offene Fragen bezüglich einer solchen Abgabe - etwa bei der Form, dem Preis, der Ausgestaltung und Erhebung sowie der Verwendung und Verteilung der erhobenen Mittel. Ohne vorgängige umfassende Abklärungen sei es in seinen Augen nicht angebracht, einen Gesetzgebungsprozess einzuleiten. Nun wird der Nationalrat über die Motion befinden. (cbe)
13:38 Uhr
Donnerstag, 15. Mai
Gesundheitskosten: Bundesrat hofft auf Rezepte aus Bevölkerung

Seit Jahren suchen Bundesrat und Parlament nach Rezepten, um die Explosion der Gesundheitskosten zu bremsen. Diverse Massnahmen wurden bereits in Angriff genommen, wie beispielsweise tiefere Medikamentenpreise, mehr ambulante Behandlungen oder eine bessere Koordination zwischen Ärzten, Spitälern und anderen Akteuren. Doch das reicht nicht. Die Kosten steigen und steigen.
Nun ist der Bundesrat offenbar schon so verzweifelt, dass er die Bevölkerung um Rat bittet. Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider hat eine Ideenbörse lanciert: Per Online-Formular kann man konkrete Vorschläge einreichen, wie Kosten gesenkt werden können. Bis Mitte Juni nimmt der Bund Ideen entgegen. Eine Expertengruppe wird sie dann anschauen und allenfalls aufgreifen.
Die Aussicht auf tiefere Prämien für alle muss dabei Anreiz genug sein: Eine Belohnung gibt es nicht, sollte eine zündende Idee tatsächlich weiterverfolgt werden. Die Teilnahme erfolgt nämlich auch komplett anonym - wer mitmacht, wird explizit aufgefordert, keinen Namen anzugeben. Man darf gespannt sein, was für Ideen da so zusammenkommen, auf die die Politik all die Jahre noch nicht selber gekommen ist. (lha)
16:44 Uhr
Mittwoch, 14. Mai
Einsicht in die EU-Verträge für alle Parlamentarier
Noch sind die Verträge zwischen der Schweiz und der EU geheim. Pro Partei bekamen aber zwei Parlamentarier die Möglichkeit, die Verträge in einem so genannten Reading Room zu lesen. Das empörte viele Politikerinnen und Politiker aller Couleur. Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats schrieb in einem scharfen Brief an den Bundesrat: «Vorgezogene selektive Einsichtmöglichkeiten für einzelne Ratsmitglieder» seien zu unterlassen. Entweder müssten alle Einsicht haben – oder niemand.
Nun reagiert der Bundesrat: Alle Mitglieder der eidgenössischen Räte können auf Anfrage Einsicht in die Abkommenstexte nehmen. Es gilt die Geheimhaltungspflicht. Damit trage er dem ausserordentlichen parlamentarischen Interesse an diesem Dossier Rechnung, schreibt die Landesregierung. So oder so beabsichtig der Bundesrat noch vor der Sommerpause über die Eröffnung der Vernehmlassung zu entscheiden. In diesem Rahmen sollen die Abkommenstexte, die dazugehörige Umsetzungsgesetzgebung sowie die innenpolitischen Begleitmassnahmen wie vorgesehen in den drei Amtssprachen veröffentlicht werden. (dk)
16:04 Uhr
Mittwoch, 14. Mai
Zoll kann mit Piraterieprodukten kurzen Prozess machen
Gefälschte Markenkleidung, Handtaschen, Schuhe oder Luxusuhren kommen in rauen Mengen in die Schweiz. Die Produktimitate werden mehrheitlich im Internet bestellt und per Post oder Kurier in die Schweiz geliefert. Bei über 90 Prozent der an der Grenze festgestellten Fälschungen handelt es sich um Kleinsendungen mit bis zu drei Gegenständen. Das heutige Verfahren zur Vernichtung dieser Fälschungen ist aufwendig und bedeutet viel Arbeit für die Zollbeamten. Denn es müssen nicht nur die Bestellerinnen und Besteller der Ware informiert werden, sondern auch Rechteinhaber, also das von der Fälschung betroffene Unternehmen.
Der Bundesrat hat nun am Mittwoch entschieden, das Verfahren zu vereinfachen. Künftig müssen nur noch die Käufer der Ware informiert werden. Stimmen sie zu, kann die Ware vernichtet werden. Nur wenn sie nicht einverstanden sind, wird der Rechteinhaber auch künftig informiert, damit er weitere Schritte einleiten kann. Die Einfuhr von Waren, die das Immaterialgüterrecht verletzen, bleibt straffrei. (dk)
15:26 Uhr
Mittwoch, 14. Mai
Bund erhöht Gelder für den Schutz jüdischer Einrichtungen
Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, die finanzielle Unterstützung von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen zu erhöhen. Er will dafür 2026 und 2027 jährlich 6 Millionen Franken zur Verfügung stellen. Danach soll der Betrag wieder auf 5 Millionen Franken sinken, wie in den Jahren 2024 und 2025.
Der Bundesrat schreibt in der Medienmitteilung, er wolle auch künftig einen wichtigen Beitrag zum Schutz der gefährdeten Minderheiten vor terroristischen oder gewalttätig-extremistischen Angriffen in der Schweiz leisten.
Der Bundesrat begründet die temporäre Erhöhung mit der angespannten Sicherheitslage. Die Gesuche für die finanzielle Beteiligung an Schutzmassnahmen hätten die verfügbaren Mittel deutlich überstiegen. Der Nachrichtendienst des Bundes entscheidet basierend auf einer Bedrohungsbeurteilung, bei welchen Minderheiten ein besonderes Schutzbedürfnis vorliegt. Aktuell trifft dies bei jüdischen und muslimischen Organisationen sowie der LGBTQ+ Gemeinschaft zu. (dk)
16:17 Uhr
DIENSTAG, 13. MAI
Nächste Woche werden neue EU-Abkommen paraphiert
Am Mittwoch 21. Mai wird Staatssekretär Patric Franzen in Bern im Beisein des EU-Chefverhandlers seine Initialen unter die neu ausgehandelten EU-Verträge setzen. Das hat CH Media aus zuverlässiger Quelle erfahren. Im Fachjargon nennt man diesen Akt «Paraphierung» und es bedeutet, dass die juristische Prüfung der Vertragstexte abgeschlossen ist.
Zufall oder nicht: Die Paraphierung kommt auf den Tag genau 25 Jahre nach der Abstimmung über die Bilateralen I. Dieses Paket von sieben bilateralen Verträgen wurde am 21. Mai 2000 mit 67,2 Prozent von Volk und Ständen angenommen. Es bildete nach dem EWR-Nein von 1992 den Grundstein der heutigen Beziehung zur EU. Neben dem Zugang zum europäischen Binnenmarkt gehört unter anderem der freie Personenverkehr dazu.
Ein Vierteljahrhundert später kann nun also das dritte Vertragspaket in die Vernehmlassung geschickt werden. Dieser Schritt dürfte Mitte Juni folgen. Dann werden die in die Landessprachen übersetzten Abkommen auch veröffentlicht. Der bilaterale Fahrplan sieht weiter vor, dass bis Ende Oktober die Konsultation von Parteien, Sozialpartnern, Wirtschaft und allen anderen Anspruchsgruppen abgeschlossen ist. Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres wird der Bundesrat die Abkommen offiziell unterschreiben und in der Frühjahrssession zur Beratung ins Parlament schicken. Stimmt dieses zu, könnten die Vorlagen theoretisch noch vor den Wahlen im November 2027 an die Urne kommen. Ob dieser Zeitplan eingehalten wird, ist jedoch ungewiss. (rhe)

15:53 Uhr
Sonntag, 11. Mai
Referendum gegen Lockerung der Kriegsmaterialexporte angekündigt
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, GSoA, wird gegen eine allfällige Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes das Referendum ergreifen. «Schweizer Kriegsmaterial darf nicht in Unrechtsstaaten landen, die Menschenrechte verletzen», wird GSoA-Sekretär Joris Fricker in einer Medienmitteilung am Sonntag zitiert. Der Bundesrat hat im Februar die Botschaft zur Revision des Kriegsmaterialgesetzes verabschiedet. Sie wurde durch die Debatte über den Export von Kriegsmaterial im Kontext des Ukraine-Krieges angestossen. Mit der Vorlage soll der Bundesrat die Möglichkeit erhalten, im Falle ausserordentlicher Umstände und zur Wahrung der Interessen der Schweiz von den Bewilligungskriterien für Auslandsgeschäfte abzuweichen. Aus Sicht der GSoA werden damit die vor wenigen Jahren in Kraft getretenen Errungenschaften der Korrektur-Initiative torpediert.

Die 70 Mitglieder der GSoA positionierten sich an ihrer Vollversammlung in Solothurn ausserdem gegen den Kauf des US-Kampfjets F-35: «Der F-35 ist ein Sicherheitsrisiko für die Schweiz. Der Kauf muss gestoppt werden, bevor die Kosten explodieren.» (sbü.)
11:32 Uhr
Donnerstag, 8. Mai
Graubünden vor Einführung des Stimmerechtalters 16
Der Kanton Graubünden hat die Vernehmlassung für die Einführung des Stimmerechtsalters 16 eröffnet. Der Grosse Rat hatte die Regierung im Juni 2022 beauftragt, die entsprechenden Rechtsgrundlagen zu schaffen. Der Regierungsrat schlägt nun eine Teilrevision der Verfassung vor. Das heisst: Letztlich wird das Volk über eine Senkung des Stimmrechtsalters entscheiden.
Bis jetzt dürfen nur im Kanton Glarus Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren politisch mitbestimmen. In zahlreichen Kantonen, zuletzt in Luzern, scheiterten entsprechende Vorhaben an der Urne. In der Frühlingssession 2024 verwarf sodann der Nationalrat einen Vorstoss für das Stimmrechtsalter 16 auf nationaler Ebene. (kä)
11:29 Uhr
Donnerstag, 8.Mai
Verkauft Schweiz doch Panzer an Deutschland?
Der staatliche Schweizer Rüstungskonzern Ruag nimmt nach einem gescheiterten Panzer-Geschäft mit Deutschland einen neuen Anlauf. Angesprochen auf eine Recherche des Schweizer Senders SRF bestätigt das Unternehmen Gespräche über «die Möglichkeit eines Verkaufs», will aber keine weiteren Auskünfte geben.
SRF berichtet, die Ruag wolle 96 in Italien geparkte Leopard-1-Panzer wie schon vor zwei Jahren an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall verkaufen. Damals waren die Panzer für die Ukraine gedacht. Das Geschäft stoppte die Regierung 2023 unter Verweis auf die Neutralität der Schweiz in allen kriegerischen Auseinandersetzungen.
Dieses Mal habe das deutsche Unternehmen zugesichert, dass die Panzer nicht in die Ukraine gehen sollen, berichtete SRF. Sie könnten etwa als Ersatzteillager genutzt werden. Die Ruag soll nach dem Bericht bereits einen Antrag zum Verkauf beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gestellt haben. Die Ruag kaufte die Panzer aus Beständen der italienischen Armee 2016. Sie stehen bis heute auf einem Gelände in Norditalien. (dpa)
11:09 Uhr
Donnerstag, 8. Mai
Weniger Tätlichkeiten gegen Transportpolizei: Bodycams bewähren sich
Seit letztem September setzt die Transportpolizei schweizweit Bodycams ein. Aufnahmen können als Beweismittel dienen. Nach einem halben Jahr ziehen die SBB ein positives Zwischenfazit. Wie sie am Donnerstag mitteilten, ist die Zahl der Tätlichkeiten gegen die Transportpolizei um einen Viertel gesunken. Die Bodycams würden sich als Mittel zur Deeskalation bei Konflikten bewähren. «Die Einführung der Bodycams war ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden. Wir sind optimistisch, dass sich der positive Trend der ersten sechs Monate fortsetzt», sagt Michael Perler, Kommandant der Transportpolizei.
Gemäss einer internen Umfrage beurteilen 90 Prozent der Polizistinnen und Polizisten den Einsatz von Bodycams als sinnvoll. Insgesamt wurde im ersten Halbjahr 331 Mal die Bodycam ausgelöst. 107 Aufnahmen dienten als Beweismittel. Davon wurden 15 aufgrund einer entsprechenden Verfügung den Strafverfolgungsbehörden übergeben. 224 Aufnahmen wurden frühzeitig gestoppt, weil sich die Konflikte nach Start der Aufnahmen in vielen Fällen sofort entschärfte. (kä)
17:31 Uhr
Mittwoch, 7. Mai
Nationalrat fordert «marktgerechtere» Löhne fürs Bundespersonal
Die Löhne der Bundesangestellten: Sie sind zu hoch, um fair zu sein. Dieser Meinung ist eine Mehrheit des Nationalrats. SVP, FDP, Mitte und GLP haben einem Vorstoss von Grünliberalen-Präsident Jürg Grossen zugestimmt, der «marktgerechtere Löhne» beim Bund fordert.
«Die Löhne in der Bundesverwaltung entwickeln sich seit Jahren mit einer Dynamik, mit der die Privatwirtschaft nicht mithalten kann», findet Grossen. Für KMUs sei das ein Problem. Die konkrete Forderung des Berner Nationalrats: Die Löhne der Bundesbeamten sollen nicht stärker steigen dürfen als jene in der Privatwirtschaft.
Vergangene Woche erst hatte der Bundesrat eine Reform des Lohnsystems beschlossen - als Reaktion unter anderem auf diesen Vorstoss. Doch den Bürgerlichen geht dieser zu wenig weit, beziehungsweise er ist aus ihrer Sicht in Teilen sogar kontraproduktiv: So hat die Regierung beschlossen, dass die Lohnkurven künftig weniger stark steigen und nicht mehr automatisch zum Maximallohn pro Lohnklasse führen - dafür wird das Anfangsgehalt angehoben. Letzteres verschärft, findet Grossen, die Konkurrenzsituation nur noch.

SP-Nationalrätin Barbara Gysi - Präsidentin des Personalverbands des Bundes - warnte, dass «marktgerechtere Löhne» unter dem Strich bedeuteten, dass die untersten Lohnklassen, zum Beispiel Reinigungspersonal oder Logistiker, weniger verdienen würden. Denn es ist der Tieflohnbereich, in dem der Bund derzeit deutlich besser als die Privatwirtschaft zahlt. Man könne die Löhne zudem nicht einfach so miteinander vergleichen, kritisierte Gysi. Oft würden für Bundesangestellte beispielsweise hohe Sicherheitsanforderungen gelten.
Eine Mehrheit des Nationalrats ist trotzdem der Meinung, dass der Bund nachbessern muss. Nimmt auch der Ständerat den Vorstoss Grossens an, muss die Regierung noch einmal über die Bücher.
16:28 Uhr
Mittwoch, 7. Mai
Steuerprivileg für Tourismus soll verlängert werden
Er war einst als Krisenhilfe konzipiert: Der tiefere Mehrwertsteuersatz für die Hotellerie. Eingeführt wurde er 1996 als eine Rezession, der starke Franken und die harte Konkurrenz im Ausland dem Schweizer Tourismus zu schaffen machten. Als Kriseninstrument war die Massnahme befristet. Doch der Sondersatz für Beherbergungsdienste (Übernachtung und Frühstück) von 3,8 Prozent soll nun bereits zum siebten Mal verlängert werden - die aktuelle Regelung läuft Ende 2027 aus. Der Normalsatz beträgt derzeit 8,1 Prozent.
Nach dem Ständerat hat am Mittwoch auch der Nationalrat einer entsprechenden Motion der St.Galler Ständerätin Esther Friedli (SVP) zugestimmt mit 119 zu 59 Stimmen. Eine Minderheit um GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy sprach sich gegen diese Giesskannensubvention aus. Auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter lehnte den Vorstoss ab. Sie verwies auf die gute Lage des Schweizer Tourismus. Mit 4,2 Millionen Logiernächten im letzten Jahr wurde ein neuer Rekord erreicht. Die FDP-Magistratin nannte den Sondersatz explizit eine Subvention von 300 Millionen Franken für die Hotellerie. So viel mehr würde nämlich der Bund zusätzlich einnehmen, wenn für die Branche der Normalsatz gälte. (dk)
18:52 Uhr
Dienstag, 6. Mai
Nationalrat will Schutz vor Pestiziden aufweichen
Erst zwei Jahre ist es her, da traten verschärfte Bestimmungen zum Gewässerschutz in Kraft. Nun will sie der Nationalrat bereits wieder abschwächen.
Die grosse Kammer spricht sich mit 113 zu 72 Stimmen für einen Vorstoss des Luzerner Mitte-Nationalrats Leo Müller aus, der die Kriterien für die Pestizid-Zulassung lockern will. Aktuell gilt, dass die Zulassung eines Stoffs überprüft werden muss, wenn der Grenzwert unter anderem in mindestens zehn Prozent der untersuchten Gewässer überschritten wird. Nun will der Nationalrat diesen Wert auf 20 Prozent verdoppeln.
Gewässerexperten und Wasserversorger warnten vor einer solchen Lockerung. Doch die bürgerliche Bauernlobby im Parlament setzte sich durch. Auch Umweltminister Albert Rösti weibelte für die Lockerung - aus Sorge um den Fortbestand vieler Kulturen im Land. Zwischen 2005 und 2022 seien 208 Pestizide vom Markt verschwunden, weil die EU deren Zulassung zurückgezogen hat. «Diese Situation hat in der Landwirtschaft ein echtes Problem ausgelöst», sagte Rösti. Dieses habe sich in den vergangenen Jahren, ja Monaten akzentuiert.
Noch vor zwei Jahren hatte der Bundesrat selbst diese Änderungen vorgeschlagen - sie stiessen in der Vernehmlassung auf breite Zustimmung. Sie waren Teil eines Massnahmenpakets, mit dem das Parlament 2021 der Trinkwasser-Initiative den Wind aus den Segeln nehmen wollte. Nun schon wieder Lockerungen zu beschliessen, verstosse gegen Treu und Glauben, sagte die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter. Die Mehrheit des Nationalrats sieht dies anders. Nun wird sich als Nächstes der Ständerat mit dem Vorstoss befassen. Es ist unwahrscheinlich, dass er sich gegen den Nationalrat stellt. (lha)
12:53 Uhr
Dienstag, 6. Mai
Chip für Katzen soll freiwillig bleiben
Der Nationalrat will nichts von einer nationalen Registrierungs- und Chippflicht für Katzen wissen. Mit 108 zu 80 Stimmen hat der Rat am Dienstag Nein zur entsprechenden Forderung von Grünen-Nationalrätin Meret Schneider gesagt. Rund jedes dritte Büsi in der Schweiz ist gechippt und in einer nationalen Datenbank registriert. Auch künftig soll dies freiwillig bleiben.
Der Entscheid fiel eher überraschend, da sich der Bundesrat für die Forderung starkgemacht hatte. Doch die Gegenargumente der SVP setzten sich schliesslich im bürgerlichen Lager durch. Selbst SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel, eine der Mitunterzeichnerinnen des Vorstosses, kippte und stimmte schliesslich Nein.
Eine Chippflicht bringe nichts im Hinblick auf das Problem der streunenden Katzen - schliesslich habe ein Grossteil der Streuner keinen Besitzer. Zudem warnte SVP-Nationalrat Sylvain Freymond vor den Kosten und dem Personalaufwand. Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider schlug diese Befürchtung allerdings in den Wind. Die Massnahme führe «nicht zu übermässigen Kosten», da die Infrastruktur dafür bereits bestehe.
Nationalrätin Meret Schneider hatte vergebens das Argument vorgebracht, dass jedes Jahr über 10'000 Katzen vermisst gemeldet würden. Mit einer Chippflicht können ihre Besitzer ganz einfach ausfindig gemacht werden. Auch dürften weniger Katzen ausgesetzt werden, wenn man weiss, wem sie gehören.
Der Bundesrat erhoffte sich ausserdem eine Datengrundlage um zu untersuchen, welchen Effekt die Katzen, die jedes Jahr Millionen Vögel und andere Tiere töten, auf die Artenvielfalt haben.
Ebenfalls zur Diskussion steht die weitergehende und deutlich umstrittenere Forderung, eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen einzuführen - auch diese stammt von Nationalrätin Meret Schneider. Darüber wird das Parlament erst noch zu befinden haben. Angesichts des klaren Neins zur Chippflicht dürfte diese Forderung chancenlos sein. (lha)
11:18 Uhr
Dienstag, 6. Mai
Cyber: Schweiz besorgt darüber, dass USA Vertrauen einbüsst
Die freiwillig von Privaten und Unternehmen gemeldeten Cybervorfälle in der Schweiz nehmen deutlich zu. 2024 gingen 62’954 Meldungen beim Bundesamt für Cybersicherheit BACS ein, ein neuer Rekord. Schon in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 wurden wieder 24’560 Meldungen gemacht. Damit kündigt sich für 2025 ein neuer Rekord an. Das zeigen die Zahlen, die das BACS an seiner Medienkonferenz zur Halbjahresbilanz präsentierte. Das Phänomen der Fake-Anrufe im Namen von Behörden sorgte für hohe Zahlen.
Besonders besorgt äusserte sich Direktor Florian Schütz über die zunehmende internationale Fragmentierung aufgrund der schwierigen geopolitischen Situation. Zwar steigt die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit im Cyberbereich wegen der wachsenden Abhängigkeiten von globaler Software. Doch das gegenseitige Vertrauen sinkt. «Die Cybersicherheit profitiert davon, dass wir mit sehr vielen Staaten ein Vertrauensverhältnis pflegen und Informationen austauschen. Damit können wir gemeinsam gegen Hackergruppierungen vorgehen», sagte Schütz. «Erodiert dieses Vertrauen, wird das zunehmend schwierig.»
Schütz sprach Medienberichte an, dass die USA russische Cyberoperationen nicht mehr untersuchen wollten. «Das hat gerade in der EU Verunsicherung ausgelöst», sagte Schütz. Die Schweiz erhalte Informationen oft nur noch mit der klaren Vorgabe, sie nicht mehr mit gewissen Ländern zu teilen. Das wiederum sei ein Problem, weil es gegenseitige Warnungen erschwere. (att)
19:13 Uhr
Nationalrat stimmt ohne Elektronik ab – mit Aufstehen
Kurz vor Sitzungsende des ersten Tages der ausserordentlichen Session sorgt Nationalratspräsidentin Maja Riniker für eine Überraschung. Sie lässt bei einer Motion von FDP-Ständerätin Jacqueline de Quattro die elektronische Abstimmungsanlage ausfallen – und zwar übungshalber. Die Motion will den Asylgesuchen ein Ende setzen, die nur aufgrund einer medizinischen Behandlung in der Schweiz eingereicht werden.
Der Saal wird in vier Sektoren eingeteilt: Links (rot), Mitte-Links (grün), Mitte-Rechts (blau) und Rechts (gelb). «Wer Ja stimmt, soll aufstehen oder ein Zeichen geben», sagt Nationalratspräsidentin Riniker. 128 Parlamentsmitglieder stehen auf. Einer bleibt hingegen sitzen. Er stimmt mit seinem Fuss ab und hält dabei Augenkontakt mit dem Stimmenzähler, genauso, wie er es auch in den Kommissionen macht: Mitte-Nationalrat Christian Lohr, der mit einer schweren Behinderung zur Welt gekommen ist – ohne Arme und mit missgebildeten Beinen.
Wieder setzt Riniker an: «Wer Nein stimmt, soll aufstehen oder ein Zeichen geben.» 63 Personen stehen auf. Eine Person, die aufsteht, ist allerdings kein Ratsmitglied. Es ist der persönliche Mitarbeiter von Nationalrat Islam Alijaj, der mit einer Cerebralparese im Rollstuhl sitzt. Der Mitarbeiter darf für Alijaj abstimmen. Nicht im Saal ist der dritte Nationalrat, der im Rollstuhl sitzt: Mitte-Nationalrat Philipp Kutter. Nach dem Übungstestfall lässt Riniker auch noch elektronisch und damit scharf abstimmen. Die Motion wird mit 128:62 Stimmen überwiesen. Kurioserweise je eine Stimme tiefer als ohne Elektronik (129:63 Stimmen). (att)
17:15 Uhr
Parlament will EGMR in die Schranken weisen
Das Klimaseniorinnen-Urteil wirkt nach: 2024 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Schweiz verurteilt, weil sie den Klimawandel nicht angemessen bekämpfe. Damit verstosse die Schweiz gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, so das Urteil. Dieses gab in der Schweiz viel zu reden - und hat nun auch Folgen. Nach dem Ständerat hat am Montag auch der Nationalrat entschieden, dass der Bundesrat den EGMR an seine «Kernaufgaben erinnern» muss. Namentlich soll der EGMR keine ideelle Verbandsbeschwerde zulassen und nicht mittels ausufernder Auslegung der Grundrechte den legitimen Ermessensspielraum der Staaten einschränken. Der Bundesrat soll nun im Verbund mit anderen Vertragsstaaten ein Zusatzprotokoll anstreben - er steht hinter dem Vorschlag. Die bürgerlichen Parteien stimmten zu, Widerstand kam von Links. Die SP spricht von einem schweren Schlag für den Schutz der Menschenrechte. Die Grüne Sibel Arslan (Grüne/BS) monierte, der Vorstoss wolle die Unabhängigkeit des EGMR beschneiden.
15:41 Uhr
5. Mai 2025
Lärmmessungen im Nationalratssaal
Im grossen Nationalratssaal sei es zu laut. Das stellte des Nationalratspräsidium fest und entschied darum, während der dreitägigen Sondersession den Lärmpegel zu messen. Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP/AG) erklärte, dass deswegen ein Gerät auf ihrem Pult stehe. Auch an zwei anderen Punkten im Saal wird während den nächsten Tagen gemessen.
Was die Konsequenz der Messungen ist, bleibt unklar. Riniker sagte: «Aufgrund der erhobenen Daten werden im Sommer neue Massnahmen geprüft.» (wan)
15:30Uhr
5. Mai 2025
Nationalrat beschliesst Ohrfeigen-Verbot
Die Zahlen sind beklemmend: Jedes zweite Kind erlebte in seinem Zuhause bereits eine Form von Gewalt. Zwar zeigt eine Umfrage, dass Eltern wissen, dass Körperstrafen grundsätzlich verboten sind. Doch unterscheiden sich die Auffassungen darüber, was eine Grenzüberschreitung ist: Rund ein Viertel der Eltern sind der Meinung, dass Füdlitätsch erlaubt sind.
Hier will das Parlament nun Klarheit schaffen: Der Nationalrat hat am Montag mit überwältigender Mehrheit entschieden, Gewalt aus der Erziehung zu verbannen - sei dies physisch oder psychische Gewalt. Konkret will der Nationalrat das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung gesetzlich verankern.
Der Widerstand gegen dieses Vorhaben blieb an einem kleinen Ort. Bereits in der zuständigen Rechtskommission formierte sich nur ein kleines Grüppchen von drei SVP-Männern, die gegen die Gesetzesänderung stimmten und den Antrag stellten, darauf zu verzichten. Manfred Bühler erklärte stellvertretend: «Wenn sich ein Kind schlecht benimmt, muss es zurechtgewiesen werden können.» Er verurteile systematische Gewalt, aber es könne zu einem physischen Einschreiten seitens der Eltern kommen. Meistens reiche aber alleine die Drohung. Bühler Verglich das Gewaltverbot mit der Entwaffnung der Polizei. Es brauche eine Abschreckung.
Den SVP-Männern schlossen sich im Nationalrat weitere SVP-Männer und auch vereinzelte Frauen an. Mit 53 Stimmen konnten sie aber nichts mehr am neuen Gesetzesartikel ausrichten. Dies obwohl selbst Befürworter gewisse Zweifel äusserten, inwiefern die neue Regel überhaupt Wirkung erzielt. Klar ist nämlich, dass Gewalt in der Erziehung bereits nach geltendem Recht nicht erlaubt ist.
Der neue Entscheid soll darum auch ein Signal aussenden, dass sowohl körperliche Bestrafungen sowie erniedrigende Behandlung von Kindern nicht mehr toleriert würden, wie Grünen-Nationalrätin Florence Brenzikofer ausführte. Der zuständige Bundesrat Beat Jans unterstützte das Vorhaben und erklärte, es gehe im Wesentlichen um Gewaltprävention und Hilfestellungen der Eltern. «Die Verantwortung der Erziehung liegt weiterhin bei den Eltern.» Es werde keine Erziehungsmethode vorgeschrieben - ausser Gewaltanwendung.
Weiter gehe es darum, Eltern sollen sich über gewaltfreie Erziehung informieren können. Die Kantone werden dazu verpflichtet, die Hilfe flächendeckend und bedarfsorientiert anzubieten, um die notwendige Unterstützung zu erhalten. Jans: «Die Erfahrungen im Ausland haben gezeigt, wie wichtig Hilfestellungen sind, um Gewalt effektiv zu verhindern.»
Nach dem Nationalrat muss dem Artikel auch der Ständerat zustimmen. (wan)
14:30 Uhr
5. Mai 2025
Die Sondersession des Nationalrats hat begonnen
Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP) eröffnet die Sondersession, die drei Tage dauert. Am Montag diskutiert der Nationalrat über Gewaltfreie Erziehung, mehr politische Rechte für behinderte Menschen sowie die Aufgaben des Europäischen Menschegerichtshofs.
Am Dienstag folgt die grosse Debatte über die Kita-Finanzierung, am Mittwoch entscheidet der Nationalrat über die Individualbesteuerung.
Copyright © 2025 by Vaduzer Medienhaus
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.