Der Friedens-Nobelpreis geht an Maria Corina Machado – nicht an Trump
Das ist die Preisträgerin Maria Corina Machado und ihr Wirken
Der Friedensnobelpreis 2025 wird an die Venezolanerin María Corina Machado verliehen. Die Oppositionsführerin werde für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf um einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie geehrt, sagte der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Jørgen Watne Frydnes, am Freitag. Als Führerin der Demokratiebewegung in Venezuela sei sie eines der aussergewöhnlichsten Beispiele zivilen Mutes im Lateinamerika der jüngeren Zeit.

Frydnes sagte, Machado sei eine einigende Figur in einer einst tief gespaltenen politischen Opposition, die in der Forderung nach freien Wahlen und einer repräsentativen Regierung eine gemeinsame Basis gefunden habe. Sie setze sich als Gründerin der Organisation Súmate seit mehr als 20 Jahren für freie und faire Wahlen ein. Vor der Wahl im vergangenen Jahr habe die Regierung des Sozialisten Nicolás Maduro ihre Präsidentschaftskandidatur blockiert. Machado habe daraufhin den Oppositionskandidaten Edmundo González Urrutia unterstützt. Die Opposition habe die in den Wahlkreisen des Landes erhobenen Stimmenzahlen veröffentlicht, die einen klaren Sieg der Opposition gezeigt hätten.
Der mit Maduro-Anhängern besetzte Wahlrat erklärte den Amtsinhaber trotz glaubwürdiger gegenteiliger Beweise zum Sieger. Das löste landesweite Proteste aus, auf die die Regierung mit Gewalt reagierte. Es gab mehr als 20 Tote. Machado versteckte sich und ist seit Januar nicht mehr öffentlich aufgetreten.

Machado «verkörpert die Hoffnung auf eine andere Zukunft»
Frydnes sagte, Machado habe sich unerschütterlich gegen die Militarisierung der venezolanischen Gesellschaft gewehrt und gezeigt, dass die Werkzeuge der Demokratie auch Werkzeuge des Friedens sind. Sie sei trotz Morddrohungen in Venezuela geblieben und habe damit Millionen Menschen inspiriert. «Sie verkörpert die Hoffnung auf eine andere Zukunft, in der die Grundrechte der Bürger geschützt sind und ihre Stimme gehört wird», sagte Frydnes. «In dieser Zukunft werden die Menschen endlich frei sein und in Frieden leben können.»
Doch eine bessere Zukunft ist aktuell weit weg. María Corina Machado selbst lebt gefährlich.
Die Nachricht erhält die Oppositionsführerin an einem für die Öffentlichkeit unbekannten Ort, denn Machado lebt aus Angst vor der Verfolgung der autoritären Regierung von Präsident Nicolás Maduro im Untergrund - inzwischen seit mehr als einem Jahr, wie sie selbst sagt.
«Es macht schon etwas Angst», meinte sie kürzlich in einem TV-Interview. Wie so oft stand die dreifache Mutter dabei vor einer nackten Wand: Kein Detail soll darüber Aufschluss geben, wo sie sich aufhält.
In ihrem Versteck beging die dreifache Mutter auch vor wenigen Tagen - am 7. Oktober - ihren 58. Geburtstag. Es sei traurig an solchen Tagen, denn dann werde sie sich einer Gewissheit bewusst: «Du weisst, du wirst niemanden berühren können.»
Welch ein Unterschied zu den ikonischen Bildern, für die Machado sonst in jüngerer Vergangenheit bekannt war: Da steht sie etwa - allen Einschüchterungsversuchen zum Trotz - auf dem Dach eines Autos oder auf der Ladefläche eines Lastwagens, während ihr eine Menschenmenge inmitten eines Meeres venezolanischer Flaggen zujubelt.
«Die Stimme der Hoffnung», nennen sie ihre Anhänger, für viele von ihnen ist sie auch «Die Eiserne Lady Venezuelas». Für ihre Gegner, die Unterstützer der Regierung, ist sie dagegen eine «rechte imperialistische Verschwörerin».
Die Tochter aus gutem Hause - ihr Vater war ein bekannter Unternehmer aus der Metallbranche, ihre Mutter machte sich als Psychologin einen Namen -, die an der renommierten Privatuniversität UCAB in der Hauptstadt Caracas einen Abschluss als Industrieingenieurin machte, ist für ihre Widersacher ein perfektes Feindbild. Sie sehen sie als Inbegriff einer politischen und wirtschaftlichen Elite, die es zu bekämpfen gilt.
Der 2013 gestorbene Präsident und politische Ziehvater Maduros, Hugo Chávez, nannte sie einst «eine kleine, gut aussehende Bourgeoisie», die intellektuell aber nicht auf der Höhe sei, mit ihm zu debattieren. Als junge Abgeordnete hielt sie ihm damals vor: «Das anständige Venezuela will nicht in Richtung Kommunismus schreiten». Sie bezog sich auf die Enteignungen privater Firmen, die auch ihren Vater trafen.
Jahre später, vor der Präsidentenwahl im Juli 2024, war Machado dann zur Einheitsfigur einer lange zersplitterten Opposition in dem südamerikanischen und an Erdöl reichen Land geworden, das Millionen Menschen angesichts der politischen und wirtschaftlichen Krise mittlerweile verlassen haben. Die Umfragen sagten einen haushohen Sieg der Regierungsgegner voraus.
Doch Machado, die sich selbst als Liberale definiert, war wegen angeblicher Unregelmässigkeiten aus ihrer Zeit als Abgeordnete die Ausübung öffentlicher Ämter untersagt worden - also unterstützte sie ihren Parteifreund Edmundo González (76) als Spitzenkandidaten. Trotz der Betrugsvorwürfe erklärte jedoch die linientreue Wahlbehörde schliesslich Maduro - erneut - zum Sieger. González, von vielen Ländern dennoch als gewählter Präsident anerkannt, verliess nach Drohungen und Haftbefehl Wochen später Venezuela Richtung Spanien.

Schon damals wetterte Maduro, auch gegen Machado gerichtet: «Als Bürger sage ich: Diese Leute müssten hinter Gittern sein.» Irgendwann tauchte die Oppositionsführerin dann unter. Im Januar dieses Jahres zeigte sie sich noch einmal öffentlich. Machado wurde bei einer Kundgebung im Mittelklasse-Stadtteil Chacao in Caracas begeistert gefeiert, war dann aber plötzlich verschwunden. Sie sei kurzzeitig entführt und dann wieder frei gelassen worden, berichtete sie. Die Regierung wies das zurück.
Doch seither macht sie aus dem Untergrund gegen Maduro und den nach ihren Worten von ihm geleiteten «narco-kommunistischen Staat» mobil. Sie habe alle Vorsichtsmassnahmen getroffen, um sich zu schützen, sagte sie in einem Interview mit dem Sender NTN24. Sie stellte aber auch klar: Sollte ihr etwas geschehen, sei die Absprache mit ihrem Team, wie geplant weiterzumachen. «Die Freiheit Venezuelas wird niemals über etwas verhandelt werden, das mit mir zu tun hat.»
Die Vergabe des Friedenspreises an Maria Corina Machado im Video
Powerplay: Trump forderte den Nobelpreis für sich ein
Die Vergabe des Friedensnobelpreises löste dieses Jahr zusätzliches Interesse aus. Denn US-Präsident Donald Trump warb sehr unverholen dafür, dass er ihm gebührt. Dies soll er auch in Norwegen so deponiert haben, in einem Telefongespräch mit Finanzminister Jens Stoltenberg. Und dies, obwohl die Regierung keinen Einfluss auf den Preis nimmt. Offiziell ist Trumps vorgehen aber nicht.
Trump brachte sich wiederholt als Friedensstifter ins Spiel. Zuletzt auch im Rahmen des Friedensvertrags zwischen Israel und der Hamas. Es gibt Stimmen, die Trumps Einfluss in diesem Zusammenhang durchaus würdigen. Doch es gibt gute Gründe, den Preis nicht schon dieses Jahr an Trump zu vergeben. Dass Trump überhaupt dieses Jahr zu den möglichen Preisträgern zählt ist einer israelisch-amerikanischen Professorin zu verdanken. Sie hat ihn rechtzeitig bis Ende Januar 2025 angemeldet.
Doch Friedensforscher glaubten bereits vorab nicht an eine Preisvergabe an Trump - auch weil ihrer Ansicht nach keiner der sieben von ihm genannten Konflikte wirklich nachhaltig gelöst worden ist. Auch bei Trumps Plan für Gaza ist trotz des Durchbruchs unklar, ob er dauerhaften Frieden bringen wird.
Norwegen befürchtet, dass die Vergabe des Nobelpreises an eine andere Person denn Trump dessen Zorn heraufbeschwören könnte.
Unbegründet ist dies nicht: Erstens ist Trumps Racheverhalten hinlänglich bekannt, zweitens hatte Norwegen 2010 mit der Vergabe des Preises an den chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo mit dem Zorn Chinas zu kämpfen, es kam zu ernsthaften diplomatischen Verstimmungen.
So reagiert das Weisse Haus
Das Weisse Haus reagiert empört, dass der Friedensnobelpreis nicht an US-Präsident Donald Trump geht. Das Nobelkomitee habe bewiesen, dass es die Politik über den Frieden stelle, schrieb der Sprecher des Weissen Hauses, Steven Cheung, am Freitag auf der Onlineplattform X: «Präsident Trump wird weiterhin Friedensabkommen schliessen, Kriege beenden und Leben retten», erklärte Cheung weiter. «Er hat das Herz eines Menschenfreundes, und es wird niemals jemanden wie ihn geben, der allein durch die Kraft seines Willens Berge versetzen kann», fügte er mit Blick auf Trump hinzu.
Das ist der Friedensnobelpreis
Der Nobelpreis geht auf den norwegischen Industriellen Alfred Nobel (1833 bis 1896) zurück. Am 10. Dezember werden die Gewinner offiziell ausgezeichnet. Sie erhalten dann das Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund 930'000 Franken), eine Urkunde und die Nobelpreismedaille mit dem eingravierten Namen des Preisträgers.
Der Friedens-Nobelpreis wird seit 1901 jährlich vergeben. Er kann an Personen, Personengruppen oder Organisationen vergeben werden. Den ersten Nobelpreis erhielt der Schweizer Henry Dunant für die Gründung des Internationalen Komitees vom roten Kreuze.
Seither ging der Preis über ein Dutzend weitere Male in die Schweiz. Oft an Uno-Organisationen mit Sitz in Genf.
Den letzten Friedenspreis hat die japanische Organ Nihon Hidankyō erhalten für die Bemühungen, eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen, und für den durch Zeitzeugenberichte belegten Nachweis, dass Atomwaffen nie wieder eingesetzt werden dürfen. (jk/pin/dpa)
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
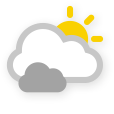








Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.