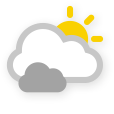Gautschi: «Das Baugeschäft war mein Spielplatz»
Die Firmengeschichte der Gautschi AG reicht bis ins Jahr 1902 zurück. Ihr heutiger CEO und Verwaltungsratspräsident Christoph Gautschi spricht im Interview über den Familienbetrieb, veränderte Rahmenbedingungen und sein Hobby auf See: «Ich segle mit
diesem Boot seit über 30 Jahren», sagt Gautschi.
Herr Gautschi, Sie sind gerade erst von der Bacardi Miami Sailing Week, der nach der Weltmeisterschaft bedeutendsten Star-Boat-Regatta zurückgekehrt. Was bedeutet Star-Boat-Segeln für Sie?
Christoph Gautschi: Es ist Entspannung und sportlicher Wettkampf zugleich, vor allem aber ist es komplett konträr zur Arbeit und macht unheimlich Spass. Star-Boat-Segeln ist Segeln auf hohem Niveau und mit gleich langen Spiessen ? jeder Teilnehmer tritt mit dem gleichen kleinen Segelboot an. Beim Bacardi-Cup sind berühmte Segler am Start, auch viele ehemalige Profi-Segler; sich mit diesen messen zu dürfen, ist für mich ein Erlebnis.
Wie wichtig ist Segeln für Sie?
Es ist Teil meines Lebens, ich segle, seit ich mich erinnern kann. Meine Eltern haben schon Star-Boat gesegelt, ich segle mit diesem Boot seit über 30 Jahren.
Star-Boat-Segeln ist komplett konträr zu ihrem Job. Wie muss man das verstehen?
Beim Regatta-Segeln muss man mit dem Kopf bei der Sache sein, das Schiff steuern, ständig den Wind beobachten und blitzschnell reagieren. Das geht nur, wenn man voll konzentriert ist. Eine Regatta bedeutet eineinhalb bis zweieinhalb Stunden höchste Konzentration, da bleibt der berufliche Alltag aussen vor.
Sie wurden in einen Traditionsbetrieb hineingeboren. War für Sie als kleiner Junge schon klar, dass Sie eines Tages ins Geschäft einsteigen würden?
Ich bin hier auf dem Firmengelände aufgewachsen, in diesem Haus, in dem wir jetzt sitzen. Hier hat sich früher unsere Schlosserei befunden, für mich als Junge war das eine spannende Sache gewesen ? das Baugeschäft war mein Spielplatz! Die Baubranche hat mich auch immer interessiert und aufgrund meiner Talente war relativ früh klar, dass ich einen technischen Beruf erlernen würde. Der Entscheid für die Baubranche fiel aber erst mit dem Eintritt in die Lehre.
Was gefällt Ihnen an der Baubranche?
Sie ist total abwechslungsreich, kein Tag ist wie der andere, man wird vom Morgen bis zum Abend immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Keine Baustelle ist wie die andere. Man kann ein Baugeschäft nicht wie eine Fabrik organisieren, in der die Abläufe planbar sind. Wir arbeiten mit einer rollenden Planung.
Sie haben von unten nach oben alle Stationen in der Unternehmung durchlaufen. Welches waren die lehrreichsten Stationen in Ihrer beruflichen Karriere?
Lehrreich und interessant waren alle ? egal, ob ich als Maurer geschuftet, Anfang der 1980er-Jahre nachts Fenster nach Zürich gefahren, im Zeichnungsbüro gearbeitet oder Bauführungen gemacht habe. Hilfreich war, dass ich durch meinen Vater von Anfang an wusste, um was es geht und wo Probleme lauern.
Welches war die härteste Zeit in Ihrer Berufskarriere?
Die schwierigste Zeit war Mitte und Ende der 1990er-Jahre, als die Banken Umstrukturierungen vornahmen und die Immobilienkrise die Schweiz ergriff. Das war keine einfache Zeit, nicht nur für mich, sondern für sehr viele KMU. Plötzlich waren die Rahmenbedingungen anders ? zuvor war man von gewissen Institutionen hofiert worden, über Nacht wurde es plötzlich unglaublich schwierig, an Kredite zu kommen.
Stichwort Rahmenbedingungen. Diese dürften sich durch das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative erneut ändern ?
? die Annahme dieser Initiative war meiner Meinung nach nicht die beste Entscheidung, die das Schweizer Volk hat treffen können. Wie sich der Entscheid konkret auswirkt, wie das Ausland längerfristig reagiert, das werden wir erst in einem halben oder dreiviertel Jahr wissen. Für die Baubranche wird es Kontingente geben, wie wir sie früher schon hatten.
Sie beschäftigen sicher auch Mitarbeiter, die keinen Schweizer Pass haben.
Wir haben viele ausländische Mitarbeiter, auch viele Grenzgänger aus Vorarlberg. Auch in Kaderpositionen. Für diese Mitarbeiter wird sich wohl nichts ändern. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich Firmen aus dem EU-Raum künftig genauer überlegen, ob sie sich in der Schweiz niederlassen wollen, wenn sie ihre Kader nicht mehr so einfach mitbringen können. Und der Entscheid wird sich auch auf Liechtenstein auswirken. Das Land hat mehr Arbeitsplätze als Einwohner; ein Teil der ausländischen Arbeitnehmer hat sich bislang in der Schweiz niedergelassen, ob das auch in Zukunft möglich sein wird, ist fraglich.
Gesamtschweizerisch zeigt der Bauindex fürs erste Quartal 2014 weiter nach oben. Wie ist Ihre Einschätzung für die Region?
Die Baugesuche bewegen sich auf Vorjahresniveau. Nach wie vor werden sehr viele Wohnungen gebaut und die Industrie investiert nach jahrelangem Baustopp wieder in Neubauten. Hier werden wir die Auswirkungen erst nächstes oder übernächstes Jahr spüren. Im Tiefbau merkt man den Trend der öffentlichen Hand zum Sparen, die Aufträge werden nicht mehr so schnell vergeben wie früher. Aber durch die Sanierung der Autobahn A1 St. Margrethen-Buriet wird in der Region in den nächsten drei Jahren im Tiefbau ein Auftrags-Volumen von 100 Millionen Franken ausgelöst.
Gautschi war an der Sanierung der A3/A13-Verzweigung Sarganserland beteiligt. Wie sehen Sie ein solches Mega-Projekt, ist das eine Herausforderung?
Das ist mehr als eine Herausforderung! Man muss aus mehreren Unternehmen eine schlagkräftige Grossunternehmung bilden und in drei Sommern ein riesiges Arbeitspensum mit Arbeitszeiten von morgens um 5 Uhr bis abends um 21 Uhr erledigen. Solche Projekte erfordern eine immense Vorbereitung und ein funktionierendes Bauführungs-Team ? in Sargans stand Chefbauführer René Köppel einem zehnköpfigen Team vor. Da ist viel Koordinationsarbeit gefragt. Allein wenn ich an die Offerte denke ? wir haben eine SBB-Palette Papier gebraucht, um sie auszudrucken. Jede beteiligte Unternehmung hatte etwas zu dieser Offerte beigetragen und die Unterlagen online an uns übermittelt. Die Datenmengen waren so gross, dass die Leitungen zusammenbrachen.
Sie waren Oberstleutnant im Militär. Hilft Ihnen die militärische Ausbildung auch im Beruf?
Im Militär erlangt man in jungen Jahren sehr schnell Führungskompetenzen. Ich war bei den Genie-Truppen und durfte als junger Leutnant vier Jahre lang einen Baumaschinen-Zug führen, habe sozusagen eine kleine Tiefbauunternehmung geleitet und dabei sehr viel gelernt. Später als Kompanie-Kommandant wurde mir grosse Verantwortung übertragen und in der Kaderausbildung lernte ich sehr schnell zu denken und zwischen Wichtig und Unwichtig zu unterscheiden.
Als Chef von 300 Mitarbeitern dürfte das für Sie enorm wichtig sein.
Das hat mit der Grösse der Firma nichts zu tun. Wenn man Entscheidungen fällen muss, kann man sich nicht stundenlang Zeit lassen und abwägen. Das kann man natürlich auch in Managerschulen lernen, aber in der Armee war diese Ausbildung gratis (lacht).
Die Gautschi-Gruppe ist breit aufgestellt. Hat man als Chef Bereiche, die einem näher stehen als andere?
Der Hauptbereich unserer Unternehmung sind Hoch- und Tiefbau, da liegt unser Schwergewicht, entsprechend muss ich mich auch am meisten darum kümmern. Tiefbau ist sehr interessant, da kommt man mit Ideen sehr viel weiter als in anderen Bereichen. Heutzutage spielt aber auch die Logistik eine entscheidende Rolle. Man muss eine Baustelle richtig organisieren, muss wissen, wie man die Arbeit anpackt, mit welchen Geräten ? Die richtige Herangehensweise ist die grössere Herausforderung als die Arbeit selbst.
Welches sind die grössten Herausforderungen für die Baubranche ? jetzt und in den nächsten Jahren?
Es ist leider so, dass viele Unternehmungen alles zu Akkordanten auslagern. Man gibt alles weg und minimiert die Kosten immer mehr. Aber irgendwann ist fertig ausgelagert. Ich finde es schade, wenn man alles, was wir ursprünglich mal gemacht haben, nun Dritten überlässt. Es gibt in der Branche ein paar riesige Global Players, die vorgeben wohin, die Reise geht. Viele KMU haben eine schwierige Grösse ? sie sind zu gross, um übergangen zu werden, aber zu klein, um mit den ganz Grossen mitzuspielen.
Spüren Sie auch die Grenznähe, drängen Vorarlberger Firmen in den Markt?
Es kommen immer wieder Vorarlberger Unternehmen ins Rheintal arbeiten, sie gehen aber auch wieder. Die Bedingungen hier und in Vorarlberg sind nicht die gleichen ? auch für uns ist es nicht einfach, in Vorarlberg zu arbeiten, vieles läuft dort anders. Die Ausschreibungen sind anders, es wird anders abgerechnet, da gibt es vieles zu beachten. Stärker spüren wir die Konkurrenz aus dem Ausland in der Schreinerei, speziell in der Fensterproduktion, wo Halbfabrikate in die Schweiz geliefert werden. Allerdings nicht in erster Linie aus Vorarlberg, sondern aus dem gesamten EU-Raum. Vorarlberg hat ein hohes Lohnniveau, dort wird nicht wesentlich günstiger produziert als bei uns. (Interview: fass)