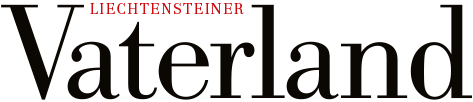Entschuldigen – die Königsdisziplin
Das mag sein, hat er doch eine der schwersten Krisen der deutschen Lufthansa – den Tod von 150 Menschen – zu verantworten und in diesen traurigen Tagen gewiss das Beste gegeben. Und dennoch überkam einen ein Gefühl der Kälte, des geplanten Krisenmanagements aus dem Handbuch – das bei der Lufthansa notabene 170 Seiten beinhaltet. Es war professionell, aber nicht authentisch. Denn auf eine solche Krise war die Lufthansa trotz Handbuch nicht genügend vorbereitet. Aus zwei Gründen: Erstens war das Szenario offenbar nicht einkalkuliert. Und zweitens steht etwas Selbstverständliches vermutlich nicht im Handbuch: die Bitte um Entschuldigung. Die jüngste harsche Kritik einiger Opfer-Angehöriger verwundert denn auch nicht.
Gewiss, die Spohr-Berater und Anwälte werden ihm dringend davon abgeraten haben, gilt doch eine Entschuldigung als Schuldeingeständnis und würde gewaltig am Image einer der
sichersten Airlines der Welt nagen. Doch beides ist zu kurz gedacht.
Die Angehörigen der Opfer wollen «entschuldigt» werden. Sie brauchen jemanden, der ihnen Halt gibt, der ihnen die grosse Last des Verlustes nimmt, sie mit ihnen teilt. Eine Bitte um Entschuldigung – und zwar wortwörtlich und verbindlich – ist mehr als ein «es tut uns sehr, sehr leid» oder «wir würden alles geben, um das Unglück ungeschehen zu machen». Ohne echte Entschuldigung tragen die Angehörigen die Last allein. Sie wollen vergeben können, das geht aber nicht, wenn man sie nicht um Entschuldigung bittet. Und sie werden sich ebenso mit Schuldgefühlen plagen, wie es wohl jedem geht, der einmal einen schweren Verlust erlitten hat. Seien dies Gedanken wie «warum haben wir sie mitfliegen lassen» oder Schuldgefühle, weil ein banaler Streit die letzte Unterhaltung war oder man sich nicht «richtig» verabschiedet hat. Betroffen sind auch alle Mitarbeitenden des Unternehmens, die ohne eine Entschuldigung des obersten Kapitäns in den Kabinen der täglichen Flüge permanent mit einer Mitschuld konfrontiert werden und die vermutlich nicht gerade Zugriff zum Krisenhandbuch haben, wenn die Menschen ängstlich vor ihnen stehen.
Ein so grosser Konzern, der «beste der Welt» (O-Ton Spohr kurz nach dem Unglück) sollte weiterdenken, als das Krisenhandbuch vorschreibt. Eine Entschuldigung ist das Üben in Demut mit der Bitte um Vergebung. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder Entschuldigungen grosser Politiker und Unternehmenschefs für Fehler der Geschichte oder der Unternehmen, die keinem geschadet haben.
Richtige Worte und Gesten sind manchmal eben doch mehr als Taten, wenn es um tiefe Emotionen, um die Hilflosigkeit von Menschen geht. Ihr Fehlen legt Zeugnis ab über die Überprofessionalisierung und damit Entemotionalisierung einer Gesellschaft. Dort verkommt die Krisenkommunikation zu einer Predigt nach Handbuch, vorbei an der Realität. Hinzu kommt, dass viele Krisenhandbücher erst bei der Krise, also dem Unfall an sich, beginnen. Noch zu selten werden mögliche Szenarien, Ursachen für Krisen, ausgearbeitet. In diesem Fall hätte die Ursache vielleicht ausgemacht und eine solche Krise sogar verhindert werden können. Ein Grund mehr, sich zu entschuldigen.
Nun hat Lufthansa-Chef Spohr die falsche Antwort auf die Kritik der Angehörigen gegeben: Er blieb letzte Woche der Trauerfeier in Frankreich fern, um «die würdevolle Zeremonie nicht zu belasten». Und liess damit die Angehörigen der Opfer einmal mehr allein. Es wirkt wie ein Festhalten an Normen, nur keinen Schritt daneben, ja keinen Fehler machen, jede Abweichung scheint gefährlich. Trotzdem hinzugehen, hätte echte Grösse gezeigt.
Wer in einer derartigen Krise Emotionen ausblendet und rein rational agiert, begeht eine der Todsünden in der Krisenkommunikation. Es nimmt den Fakten die Glaubwürdigkeit. Dabei geht beides – Professionalität und Authentizität. Eine echte Entschuldigung gehört dazu.
Copyright © 2025 by Vaduzer Medienhaus
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.