Digitalisierung: Übernehmen bald Roboter unseren Job?

Wissenschaftler, Ökonomen und Trendforscher skizzieren Geschäftsmodelle, Gadgets und Services der Zukunft, Soziologen prophezeien Brüche in der Gesellschaftsstruktur und die Medien produzieren Schlagzeilen: «Uns braucht es bald nur noch als Konsumenten», schrieb die «NZZ am Sonntag» Anfang dieses Jahres. Jeder zweite Job drohe durch Computer und Robotern ersetzt zu werden. «An die Arbeit, Roboter», befahl der «Tages-Anzeiger» bereits einige Monate vorher. Die Digitalisierung verändere Berufe radikal oder bringe sie ganz zum Verschwinden – sogar solche, die bis anhin als sicher galten. Das könne unsere Gesellschaft von Grund auf verändern.
In diesem Punkt scheint die neue Zukunftsstudie des WEF mit dem Titel «The Future of Jobs and Skills» der Zeitung recht zu geben: Bis 2020 würden in den 15 bedeutendsten Industriestaaten und Schwellenländern etwa 7,1 Millionen Arbeitsplätze verschwinden. Davon betroffen seien neben Produktion und Handwerk sowie Gesundheitswesen und Energiesektor vor allem kaufmännische Berufe in Buchhaltung und Administration. Ersetzen uns im Büro bald die Roboter wie einst in der Landwirtschaft der Traktor das Arbeitspferd? Werden Heerscharen von Angestellten bald arbeitslos?
Die Geschichte lehrt uns zweierlei. Erstens: Bereits die Einführung mechanischer Produktionsanlagen mit Wasser- und Dampfkraft im 18. und 19. Jahrhundert schürte grosse Ängste in der arbeitenden Bevölkerung. Ebenso die Einführung elektrischer Anlagen für die Massenproduktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ab den 1970er-Jahren auch die Einführung von Computer- und Informationstechnologien in Büros und Werkhallen. Tatsache ist aber, dass jede industrielle Revolution zwar kurzfristig zu Beunruhigung geführt hat, langfristig aber zu mehr Wohlstand und höherer Kaufkraft, zu kürzeren Arbeitszeiten und zu längerem und gesünderem Leben. Zweitens: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen durch die Möglichkeiten neuer Technologien werden kurzfristig über- und langfristig unterschätzt.
Neue Berufsfelder entstehen
Immerhin prophezeit die genannte WEF-Studie nämlich auch, dass durch die technologischen Veränderungen in den kommenden Jahren rund fünf Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen würden – etwa in der Informationstechnologie und Mathematik, im Ingenieurwesen oder im Marketing. Klar scheint also, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt durch mobiles Internet, Cloud-Dienste und steigende Rechenleistungen auf der einen Seite und der Trend zu flexibleren Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodellen auf der anderen Seite zu Umwälzungen der Arbeitswelt führen werden. Die Grenze zwischen Beruf und Freizeit verwischt und neue Berufsfelder entstehen – zum Beispiel für Bioinformatiker, Data Scientists oder 3-D-Drucktechnologen. Traditionelle Berufe mit vorwiegend repetitiven Tätigkeiten werden abgelöst durch neue Berufe, die neue Qualifikationen und Kompetenzen erfordern.
Dank gutem Bildungssystem, hoher Innovationskraft und nicht zuletzt einem liberalen Arbeitsmarkt gehört die Schweiz zu denjenigen Volkswirtschaften, die weltweit am besten gerüstet sind für die vierte industrielle Revolution. Ob wir die gute Ausgangslage auch nutzen können, hängt meines Erachtens vor allem von drei Voraussetzungen ab: Erstens von politischen Rahmenbedingungen, die Innovationen und freies Unternehmertum fördern. Zweitens vom Willen und der Fähigkeit von Privaten und öffentlicher Hand, weiterhin in der Schweiz in Forschung und Bildung zu investieren. Und drittens von der Bereitschaft der Arbeitnehmenden, sich ständig weiterzubilden, damit sie die Chancen des Arbeitsmarkts von morgen packen können.
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
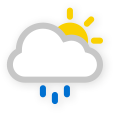



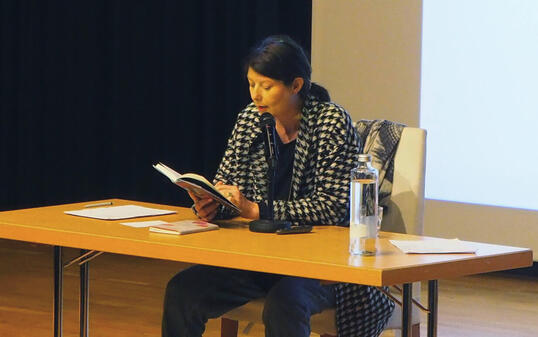

Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.