Kriterien für Personenkontrollen in Zürich
Die Stadtpolizei Zürich sah sich in den vergangenen Jahren vereinzelt mit dem Vorwurf des "institutionellen Rassismus" konfrontiert. Der Fall eines 43-jährigen Schweizers mit kenianischen Wurzeln ist derzeit am Bundesgericht hängig - er sei am Zürcher HB nur wegen seiner Hautfarbe kontrolliert worden, klagte er.
Wegen dieser Kritik, die auch zu zwei politischen Vorstössen im Stadtparlament führte, setzte Sicherheitsvorsteher Richard Wolff (AL) das Projekt "Polizeiarbeit in urbanen Spannungsfeldern (Pius)" in Gang.
Für Wolff ist klar, dass sein Korps grundsätzlich gute Arbeit leistet: Bei jährlich 60'000 Einsätzen komme es zu 300 Beschwerden, sagte Wolff am Montag vor den Medien. Darin enthalten seien viele wegen Parkbussen. "Eine Handvoll betrifft Racial Profiling".
Auch das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte, welches die Arbeit der Stadtpolizei durchleuchtete, kam zum Schluss, dass es "keine systematischen rassistischen Kontrollen" gebe.
Es braucht einen Grund
Allerdings fehlte es innerhalb der Stadtpolizei bislang an klar definierten Abläufen: Nun sollen alle Polizisten "systematisch gleich vorgehen", wie Polizeikommandant Daniel Blumer ausführte. Damit soll die hohe Qualität der Polizeiarbeit gestützt werden, und allfälliges Fehlverhalten soll minimiert werden.
Insbesondere müssen die Polizisten nun der Person, die sie kontrollieren, einen objektiven Grund nennen, warum sie sie angehalten haben. "Das Bauchgefühl alleine reicht nicht", so Blumer.
In einem Merkblatt heisst es, dass als Anlass für eine Kontrolle etwa "objektive Erfahrungswerte" (beispielsweise bekannte Verhaltensmuster von Straftätern) oder "Verhalten und Erscheinung einer Person" (etwa unstimmige Kleidung) gelten können.
In der Praxis sei bereits bislang häufig ein Grund genannt worden, sagte Blumer. Doch werde diese Vorgehensweise nun standardisiert und in einer Dienstanweisung verbindlich festgehalten.
Das Thema Personenkontrolle wird zudem auch in der Polizeiausbildung weiter ausgebaut. Das Wissen über Racial Profiling soll damit vertieft werden.
Eine Statistik, aber keine Quittungen
Neu müssen die Stadtpolizisten auch alle Personenkontrollen über eine Web-Applikation erfassen: Das Ziel ist eine Übersicht über Ort, Zeit und Grund einer Kontrolle sowie darüber, ob die Kontrolle zu einer Verzeigung oder Verhaftung führte. Schweizweit gibt es noch keine entsprechende Statistik.
Eine Quittung, wie dies teilweise gefordert wurde, wird es vorerst bei Stadtzürcher Polizeikontrollen nicht geben. Es sei nicht klar, ob ein allfälliger Nutzen den administrativen Mehraufwand rechtfertige, sagte Wolff. Ausserdem würden mit dem Ausstellen von Quittungen die Daten von allen Kontrollierten erfasst, also auch von jenen, die nicht verzeigt oder verhaftet werden. Das sei kritisch.
Eine zusätzliche Instanz für Beschwerden in Polizeiangelegenheiten wird ebenfalls nicht geschaffen. Es bestünden bereits verschiedene, auch niederschwellige Anlaufstellen, begründete Wolff. Diese sollen aber besser bekannt gemacht werden.
Frage der Kameras noch offen
Das Projekt "Polizeiarbeit in urbanen Spannungsfeldern" ist mit diesen Anpassungen bei den Kontrollen noch nicht abgeschlossen. Die Stadtpolizei testet seit Februar den Einsatz von Bodycams. Erkenntnisse darüber, ob diese Kameras "der Qualität von Personenkontrollen dienen oder nicht", sollen voraussichtlich im Frühling 2018 vorliegen.
Da die Stadtpolizistinnen und -polizisten in den vergangenen Jahren vermehrt verbalen und physischen Angriffen ausgesetzt waren, ist auch dieses Thema in "Pius" aufgenommen worden. Auch diesbezüglich dürfte im kommenden Frühling über allfällige Massnahmen informiert werden. (sda)
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben
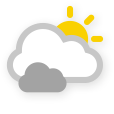





Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.