Filmbranche bibbert wegen No Billag
Als öffentlich-rechtliche Medienanstalt hat die SRG - unter anderem - den Auftrag, "zur kulturellen Entfaltung und Stärkung der kulturellen Werte des Landes" beitragen, wie es die Konzession festhält. Einen Fokus legt das Unternehmen dabei auf Schweizer Filme, Literatur und Musik.
Mit ihrem Budget - und damit auch einem Teil der jährlichen 1,2 Milliarden Gebührengelder - berichten die Sender und Redaktionen der SRG nicht nur über Kultur, sie fördern sie auch. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Medium Film: Die SRG dreht eigene Filme und Serien, subventioniert unabhängige Kinofilme und unterstützt sechs Schweizer Filmfestivals finanziell.
Festgehalten ist das alles im "Pacte de l'audiovisuel", den die SRG 1996 mit der hiesigen Filmbranche abgeschlossen hat. Jährlich 27,5 Millionen Franken investiert sie in den Film. Weitere 12,5 Millionen stecken in Serienformaten wie "Der Bestatter" sowie im Schweizer "Tatort". Somit gibt die SRG 40 Millionen im Jahr aus für den Schweizer Film.
Zum Vergleich: Die Sektion Film des Bundesamt für Kultur (BAK) hatte 2016 ein Jahresbudget von 55 Millionen Franken, wobei rund 18 Millionen in Filmproduktionen geflossen waren.
Filme machen kostet Geld. Grosse Produktionen wie "Heidi", "L'enfant d'en haut" oder der jüngst im Kino angelaufene "Papa Moll" haben Budgets von bis zu 5,5 Millionen Franken. In letzteren investierte die SRG 400'000 Franken, in "Heidi" gar 420'000, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mitteilte.
Vielfalt in Gefahr
Die Annahme von No Billag am 4. März hätte gravierende Folgen für den Schweizer Film, ist der Basler Ex-FDP-Ständerat und Präsident der Solothurner Filmtage, Felix Gutzwiller, überzeugt: "Wenn Filme nur noch nach Rentabilität produziert werden, dann wird es für die Sprachminderheiten schwierig."
Denn der Schweizer Filmmarkt ist zerstückelt, die Romandie will in der Regel andere Filme sehen als das Tessin oder die Deutschschweiz. Doch ohne Förderung lohnt es sich kaum, für diese kleinen, einzelnen Märkte Filme zu drehen - es gibt schlicht zu wenig potenzielle Zuschauer.
"Im Falle einer Annahme würde der Schweizer Film an Vielfalt einbüssen", befürchtet Gutzwiller. Für ihn ginge dieser Verlust über die Branche hinaus, denn "Filme tragen dazu bei, dass wir mitkriegen, was andere denken, wie andere leben, wie es früher war."
Mit einer Kampagne haben sich Anfang Januar auch 5000 Kulturschaffende aller Sparten gegen No Billag ausgesprochen. "Ohne SRG kein 'Das gefrorene Herz', kein 'Der schwarze Tanner', keine 'Reise der Hoffnung' - und keinen Oscar für die Schweiz", liess sich etwa Regisseur Xavier Koller zitieren. Er ist mit seinem Film "Reise der Hoffnung" (1991) der einzige Schweizer Regisseur, der je einen Oscar erhalten hat.
Initianten finden Filmförderung ausreichend
Ohne die Unterstützung der SRG müssten die Schweizer Filmemacher ihre Werke zumindest teilweise anderweitig finanzieren. Die Initianten von No Billag denken dabei etwa an "Privat- und Geschäftssponsoren", wie Sprecher Andreas Kleeb auf Anfrage der sda erklärte.
Für das No-Billag-Komitee sind die Filmförderungen von Bund und Kantonen bereits ausreichend, wie Kleeb mit Hinweis auf die entsprechenden Artikel der Bundesverfassung erklärt. Und auf SRG-eigene Formate wie "Wilder" oder "Tatort" würden die Initianten verzichten. "Diese gehören aus unserer Einschätzung kaum zu einem Service public."
Als das Schweizer Stimmvolk 2014 die Masseneinwanderungsinitiative annahm, war davon auch die hiesige Filmbranche betroffen, denn die Schweiz wurde in der Folge vom EU-Filmförderprogramm Media ausgeschlossen. Diesen Ausschluss bekommt die Branche nun zu spüren, wie Ivo Kummer, Filmchef beim Bundesamt für Kultur der sda Ende Jahr sagte. Sollte No Billag durchkommen, würde dem Schweizer Film ein weiterer herber Schlag versetzt. (sda)
Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben



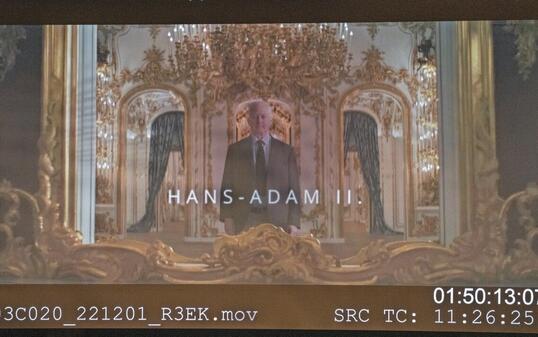

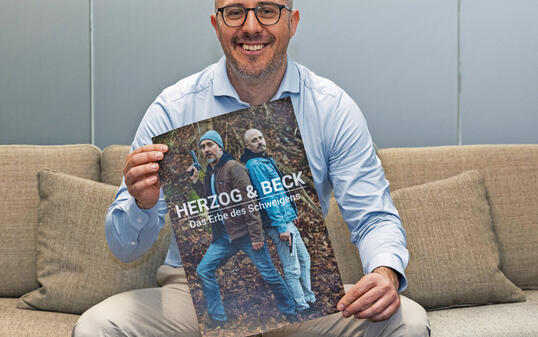

Kleines Vademecum für Kommentarschreiber
Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.
Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.
Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.
Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.
Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.
Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.
Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.
Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.
Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.
Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.
Redaktion Vaterland.li
Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.