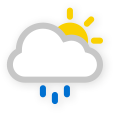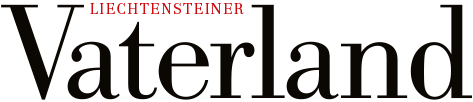NS-Zeit in Liechtenstein: «Säuberung und Sühne»
Das hätte ihnen so gepasst, den liechtensteinischen Anhängern des «tausendjährigen Reichs», dass sich der Fürst mit Hitler über die Abtretung des Lands an Deutschland verständigt hätte. In der Tat stattete Fürst Franz Josef am 2. März 1939, drei Wochen vor dem Putschversuch im Oberland, dem Führer einen Besuch ab. Dass dabei Liechtensteins Souveränität zur Disposition gestanden habe, war jedoch nichts anderes als ein Gerücht. Da sich auch nach dieser Zusammenkunft kein «Anschluss» abzeichnete, beschlossen die Mitglieder der «Volksdeutschen Bewegung in Liechtenstein» die «Heimkehr» ins «Reich» selbst in die Hand zu nehmen.
In der letzten Vorlesung der Reihe «Mord und Totschlag in Liechtenstein: Kriminalfälle aus rechtlicher und historischer Sicht» referierte Peter Geiger, Historiker am Liechtenstein-Institut, über «Klein Nürnberg in Vaduz», den Liechtensteiner Putschistenprozess in brisantem Umfeld.
Der Plan
Theodor Schädler, er nannte sich Landesleiter, und seine Genossen hatten sich die Sache recht einfach vorgestellt. Von Nendeln und Triesen aus, wo sich die Liechtensteiner Nationalsozialisten zusammenrotteten, sollten sie in zwei Trupps nach Vaduz marschieren und dort die Regierung notfalls mit Gewalt dazu zwingen, den Anschluss zu proklamieren.
Zur Unterstützung der rund 100 Liechtensteiner faschistischer Gesinnung standen in Feldkirch Männer der SA, der motorisierten NSKK und Burschen der Hitlerjugend bereit, die nachstossen sollten. Die Nendler Truppe setzte sich am frühen Nachmittag des 24. März 1939 in Bewegung und marschierte gegen Schaan. Dort formierte sich aber bereits der Widerstand. Heimattreue umstellten das Haus des Schaaner Ortsgruppenleiters, in dem sich 22 Nazis verschanzt hatten.
Der Strich durch die Rechnung
Der damalige Regierungsrat Kanonikus Anton Frommelt stellte sich den Aufständischen an der Einmündung des «schwarza Strössle» in die Landstrasse beherzt entgegen und konnte sie nach einigem Hin und Her zum Umkehren bewegen. Sie marschierten zurück, viele davon gleich nach Feldkirch, um dort festzustellen, dass der Einmarsch der Hitlertruppen in Liechtenstein von oberster Stelle in Berlin gestoppt worden war: Knappe zehn Minuten vor dem Marschbefehl.
Nicht dass Liechtensteins Souveränität dort jemandem besonders am Herzen gelegen wäre; die Reichsbehörden hatte Angst, sich lächerlich zu machen. Da davon ausgegangen werden musste, dass Franz Hofer, der Tiroler Gauleiter, über die geplante Aktion Bescheid wusste, es untergeordneten Stellen aber verboten war, Aussenpolitik zu betreiben, setzte Berlin den Schlusspunkt. Die braunen Gesinnungsgenossen in Triesen warteten vergeblich auf ihren Einsatz – gegen drei Uhr nachts trollten sie sich schliesslich nach Hause.
Im Haus des Schaaner Ortsgruppenleiters wurden 13 Nazis noch in derselben Nacht in Schutzhaft genommen und nach Vaduz expediert. Etwa 60 weitere wurden in den drauf folgenden Tagen verhört, es kam zu 53 Anklagen. Die Vorwürfe: Hochverrat, Aufstand, Freiheitsbeschränkung, unerlaubtes Tragen von Waffen, unerlaubtes Tragen von Uniformen, unbewilligte Kundgebung und Mitschuld an alledem. Da Hochverrat und Aufstand nach dem damals geltenden Strafgesetz – dem österreichischen – mit dem Tod durch den Strang sanktioniert werden konnte, mussten gemäss Strafprozessordnung acht der Angeklagten in Untersuchungshaft genommen werden.
Geschickt aus der Affäre gezogen
In Zeiten wie jenen des Herbsts 1939 war es allerdings alles andere als opportun, gegen Hitler-Anhänger einen Prozess anzuzetteln. Zumal die deutsche Führung Liechtenstein signalisierte: «Macht mit den Gefangenen was ihr wollt, aber keinen Prozess.» «Geschickt», sagte Peter Geiger, löste die Regierung dieses heikle Problem. Man einigte sich darauf, die Anklage zu ändern auf «Beteiligung am Hochverrat auf entfernte Weise». Damit waren keine Todesurteile mehr zu ällen, die Untersuchungshaft also hinfällig und die Vertagung der Prozess-Eröffnung möglich. Die Gefangenen wurden unter der Bedingung «Wegzug ins Reich» entlassen.
Vergessen wurden sie nicht: Schon vier Tage nach der Kapitulation Deutschlands forderte das «Aktionskomitee heimattreuer Liechtensteiner» die Verhaftung der Putschistenführer und die Bestrafung der Putschisten. Sechs Tage später war der Prozess von der Regierung beschlossene Sache. Nach einer öffentlichen Schlussverhandlung wurde das Urteil am 25. Januar 1945 öffentlich verkündet: Vier der sechs des Hochverrats Angklagten wurden schuldig, zwei freigesprochen. Das Medieninteresse war gross: «Liechtenstein rechnet mit seinen Landesverrätern ab», «Säuberung und Sühne», oder «Klein Nürnberg in Vaduz» lauteten Schlagzeilen in der Schweizer Presse. Im Gegensatz zur Eidgenossenschaft fassten die hiesigen Gerichte die Hochverräter mit Samthandschuhen an und gewährten ihnen alle erdenklichen Milderungsgründe. Bis vor Kurzem, bestätigte Peter Geiger, war das Thema ausserdem tabu. Keiner wollte über die damaligen Geschehnisse recht Bescheid wissen.
Übrigens: Den Tatbestand des Hochverrats gibt es noch heute im Liechtensteiner Strafgesetzbuch, definiert unter anderem als «Nötigung von Mitgliedern des Landtags oder der Regierung». Unter Todesstrafe steht Hochverrat nicht mehr. Die ist seit 1989 verboten. (shu)
Copyright © 2025 by Vaduzer Medienhaus
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.