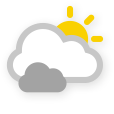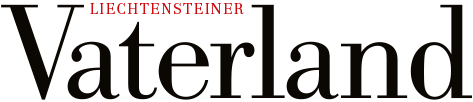Doppelmoral schafft Missstände
INTERVIEW: JANINE KÖPFLI
Frau Matt, in Liechtenstein ist Prostitution zwar nicht erlaubt, aber auch nicht richtig verboten. «Liechtenstein bewegt sich auf dünnem Eis», sagte kürzlich Dorothea Winkler vom Fraueninformationszentrum FIZ in Zürich. Was müsste sich an der rechtlichen Situation in Liechtenstein ändern?
Patricia Matt: Die Veränderung der rechtlichen Situation in Liechtenstein setzt eine gesellschaftliche Wahrnehmung der bestehenden Situation voraus. Die Podiumsdiskussion beim Projekt «Frauenhandel – Menschenhandel, Sexarbeit in Liechtenstein» vor einer Woche hat klar gezeigt, dass sich in einem ersten Schritt die Doppelmoral auf gesellschaftlicher Ebene verändern müsste. Es besteht eine Spaltung zwischen dem moralischen Anspruch einerseits und der sexuellen Realität andererseits. Das heisst, es gibt Prostitution in Liechtenstein, aber wir benennen sie nicht. Damit vermeiden wir, uns mit der Prostitution und notwendigen gesetzlichen Regelungen auseinanderzusetzen. Solange das Sexgewerbe arbeitsrechtlich gesehen im illegalen Bereich bleibt, ist die Gefahr hoch, dass wir gesellschaftspolitisch eine Grundlage für die Ausbeutung dieser Frauen schaffen.
Frau Matt, Sie sprachen von einer Enttabuisierung der Prostitution, ja sogar von einer Legalisierung. Wäre eine Legalisierung von Prostitution denkbar?
Wenn wir uns erlauben, einen Blick über die Ländergrenzen Liechtensteins hinaus zu werfen, gibt es dafür bereits existierende Modelle. In der Schweiz ist die Prostitution für selbstständigerwerbende Frauen legalisiert. In Deutschland gibt es ein Prostitutionsgesetz. Es ist an der Zeit, Prostitution als ein uraltes Gewerbe anzuerkennen. Prostitution ist ein Markt, der in Liechtenstein nachgefragt wird. Die Kabaretttänzerinnen in Liechtenstein brauchen nicht einen Arbeitsvertrag als Tänzerinnen, sondern normale Arbeitsverträge, die die Dienstleistungen, die sie ausführen, beinhalten. Nur so können arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen, wie in anderen Gewerben auch, in Kraft treten. Nur so können wir unsere Verantwortung als Gesellschaft und als Behörden wahrnehmen, dafür zu sorgen, dass diese Frauen weder kriminalisiert noch ausgebeutet werden. Ebenso dienen geregelte Arbeitsverträge dazu, die Gesundheit der Sexarbeiterinnen sowie ihrer Kunden und damit auch deren Familien zu schützen.
Durch Ihre Arbeit bei der Fachstelle für Sexualfragen kommen sie mit den Frauen, die im Sexgewerbe arbeiten, in Kontakt. Wie geht es diesen Frauen? Wie leben sie in Liechtenstein?
Diese Frauen leben unter sogenannt prekären, also unsicheren Arbeitsbedingungen. Zwei Drittel der Frauen kommen aus osteuropäischen Ländern, ungefähr ein Drittel der Frauen stammt aus Südamerika und Asien. Diese Frauen sprechen nicht unsere Sprache, sie arbeiten in der Nacht und sie schlafen am Tag. Sie sind hier, weil sie ihre Familien zu Hause ernähren wollen. Ihre Familien zu Hause wissen in der Regel nichts von den sexuellen Dienstleistungen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Die Frauen sind sozial isoliert und es herrscht ein Konkurrenzdruck untereinander. Sie dürfen maximal ein bis drei Monate an einem Ort arbeiten, maximal acht Monate bei uns in Liechtenstein. Viele der Frauen klagen über diverse Unterbauchbeschwerden und über die Folgen des mit ihrer Arbeit verbundenen obligatorischen Alkoholkonsums. Viele der Frauen konsumieren Schmerzmittel, um ihre Situation auszuhalten. Viele Frauen haben Gewalterfahrungen. Sie sind den Forderungen sowohl ihrer Kunden wie auch ihrer Arbeitgeber durch fehlende gesetzliche Regelungen ungeschützt ausgesetzt.
Ist Menschenhandel ein Thema?
Was Prostitution angeht, ist Liechtenstein ein Teil des schweizerischen Arbeitsmarktes. So macht es meines Erachtens Sinn, den Menschenhandel in der Sexarbeit in diesem Rahmen anzuschauen. Die konkrete Gefahr von Menschenhandel scheint in Liechtenstein gering zu sein. Wie wir wissen, haben viele Frauen aufgrund schlechter Erfahrungen mit Behörden und ihren Arbeitgebern Angst davor, auszusagen. Die Angst davor, wenn sie aussagen, ihren Job zu verlieren, ist hoch. Ich meine, wir müssen die Gefahr des Menschenhandels ernst nehmen. Auch weiterhin ist es notwendig, vonseiten der Behörden und der sozial tätigen Institutionen Präventionsarbeit gegen Menschenhandel zu leisten. Dies war mit ein Ziel des Projektes «Frauenhandel und Menschenhandel, Sexarbeit in Liechtenstein».
Mit einer Kampagne soll die Bevölkerung für die Themen der Prostitution und Frauenhandel sensibilisiert werden. Kann Aufklärung helfen?
Ja. Nur indem wir hinschauen, indem wir Prostitution und Menschenhandel benennen und uns die aktuelle Situation in Liechtenstein bewusst machen, kann der anstehende Handlungsbedarf benannt und hoffentlich auch angegangen werden.
Auch an Schulen werden Workshops zu diesen Themen durchgeführt. Mit Erfolg? Wie reagieren die Jugendlichen darauf?
Anhand der Bilder der Ausstellung von «Glanz und Glamour» war es den Jugendlichen möglich, sich unvoreingenommen mit der Lebenssituation der Sexarbeiterinnen auseinanderzusetzen. In den anschliessenden Gesprächen wurde das Mitgefühl der Jugendlichen mit den betroffenen Frauen spürbar.
Welches sind die Inhalte eines solchen Workshops?
Der Einstieg in die Workshops geschieht über den Ausstellungsbesuch von «Glanz und Glamour». Die Bilder der Ausstellung zeigen Orte der Prostitution, sie zeigen Sexarbeiterinnen in ihren Arbeitssituationen, sie zeigen Menschenhändler in ihrer Lebenssituation und sie zeigen Präventionsmassnahmen gegen Menschenhandel auf. Dann fanden in einem geschützten Rahmen innerhalb der Gruppe Gespräche über die eigenen Eindrücke und Gefühle statt. Spielerisch habe ich Wissen über die aktuelle Situation für Liechtenstein in Form eines Quiz vermittelt. In einem abschliessenden Schritt und anhand des Filmes «Lilya forever» setzen sich die Jugendlichen mit der Lebenssituation einer jungen Russin auseinander, die in die Zwangsprostitution geraten ist. Durch die vielen Eindrücke und die Reflexion dieser Lebensgeschichte geschieht aktive Präventionsarbeit mit den Jugendlichen.
Regierungschef Klaus Tschütscher sagte kürzlich, dass wir vor allem drei Dinge tun können: Aufklären, die offenen Handlungsfelder definieren und handeln. Wo müsste zuerst gehandelt werden?
Darin kann ich den Regierungschef vollumfänglich unterstützen. Das Projekt «Frauenhandel – Menschenhandel, Sexarbeit in Liechtenstein» hat mit allen beteiligten Institutionen zu einer Aufklärungsarbeit beigetragen. Bei der Podiumsdiskussion sind die offenen Handlungsfelder benannt worden: Es braucht eine gesellschaftliche Diskussion unserer Werthaltungen zum Thema Prostitution. Zur Enttabuisierung und Legalisierung der Prostitution sind konkrete gesetzliche Änderungen notwendig. Kabaretttänzerinnen brauchen reguläre Arbeitsverträge, um vor gesundheitlichen und arbeitsrechtlichen Ausbeutungssituationen geschützt zu werden. Es braucht eine rechtliche Verbesserung des Schutzes für die Opfer von Menschenhandel. Internationale Regelungen wie der ausserprozessuale Zeugenschutz müssen in Liechtenstein übernommen werden.
Copyright © 2025 by Vaduzer Medienhaus
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.