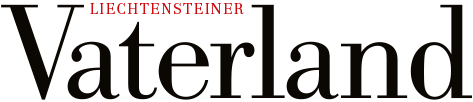«Cutting the edge» ? oder sich an Grenzen wagen
«Cutting the edge» steht auf dem Rücken der graublauen Daunenjacke, die William Maxfield bei Probenbeginn im Vaduzer Saal über einen Stuhl hängt. «Cutting the edge», was soviel bedeutet wie «sich an Grenzen wagen oder Neues, Innovatives ausprobieren». Dass dies tatsächlich bezeichnend ist für den Amerikaner, der vor bald fünfzehn Jahren nach Liechtenstein kam, merkt schnell, wer sich mit dem Musikexperten unterhält und das Vergnügen hat, ihn bei einer Probe zu beobachten.
Probenbesuch
Es ist Mittwochabend, kurz nach 17 Uhr: Die Probe zur Operette Polenblut, die am 23. Februar Premiere feiert, ist in vollem Gange. Auf der Bühne singen Helena und ihr Vater Zarémba von den Vorzügen, die eine Ehe mit dem Frauenhelden Bolo hätte. Regisseur Leopold Huber und William Maxfield als musikalischer Leiter der Produktion verfolgen die Szene kritisch, lassen wiederholen, sorgen aber immer wieder für eine auflockernde Bemerkung. Am Set geht es nicht nur strikt und ernst zu, sondern es wird auch gelacht, was für eine angenehme, sehr entspannte Atmosphäre sorgt. William Maxfield, den vor Ort alle kameradschaftlich «Bill» nennen, schwärmt von der Arbeit des Regisseurs, der offen für Ideen ist und auch den Solisten Raum lässt, sich zu entfalten. «Wir ergänzen uns gut», sagt William Maxfield und freut sich, dass Leopold Huber bereit war, die Operette sanft aufzubrechen, sie mit einer anderen Musikrichtung und Ballett zu kombinieren, ihr auch dunkle Elemente beizumischen, um sie etwas vom generell geltenden Friede-Freude-Eierkuchen-Image wegzubringen und die Spannung zu steigern. Die Elemente seien nicht übertrieben, ergänzt William Maxfield gleich, um nicht ein falsches Bild heraufzubeschwören. Die Operette sei immer noch eine Operette – ein unterhaltsames Bühnenstück mit leichter, eingängiger Musik. Traditionell, zumindest was die Musik, die Bühnenausstattung und die Kostüme angeht – «Details werden aber einen modernen Touch reinbringen.» William Maxfield zwinkert verschwörerisch.
Begeisterung für Kombination
Dass einer wie William Maxfield, der eigentlich von der klassischen Musik her kommt, der Kirchenchormusik zu seinen Steckenpferden zählt und ursprünglich Jazzmusiker werden wollte, überhaupt als musikalischer Leiter bei einer Operette landet, verwundert auf den ersten Blick, hat aber durchaus seine Berechtigung, denn Maxfield liebte schon immer die Kombination von Musik und Schauspiel. «Ich mag Dramen, Tragödien – Geschichten, die das Leben schreibt.» Auch Musicals haben für den Musiker einen Reiz – «alles, was mit Menschen zu tun hat.» Wenn es um das Dirigieren von Symphonien geht, stehe vor allem eine Idee im Zentrum, es handle sich vielmehr um eine musikalische Architektur oder um eine Philosophie. Für Maxfield sind Musikgenres wie Operette oder Musicals so etwas wie ein Kontrastprogramm zu seiner Arbeit beispielsweise als Leiter des Chorseminars oder als musikalischer Leiter des Kirchenchors zu St. Florin in Vaduz.
Ein Kalifornier
William Maxfield ist in Santa Barbara in Kalifornien in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Zwar war der Vater Trickfilmzeichner in Hollywood, Musik – vor allem Chormusik – spielte aber dank der Mutter eine grosse Rolle. «Wir haben sehr oft gesungen», erinnert er sich. «Damals spielte Musik auch an den Schulen eine viel wichtigere Rolle als heute.» Gerne denkt er an seine Musiklehrerin in der High School zurück. «Sie war eine ausgezeichnete Chorleiterin, die uns beispielsweise Bach Motetten singen liess.» Als Botschafter der amerikanischen Regierung machte der Chor sogar einmal eine Tournée durch Osteuropa. Bis heute ist sie eine der besten Chorleiterinnen, die Maxfield je gesehen hat. Kein Wunder, dass sie ihn in seiner musikalischen Karriere entscheidend prägte.
Seine musikalische Ausbildung absolvierte er an der Ecole Normale de Musique de Paris – auf Trompete. «Eigentlich wollte ich ja Jazzmusiker werden», sagt Maxfield. Zum Dirigieren sei er erst später durch Zufall gekommen. Ein Freund fragte ihn, ob er seine selbst komponierte Kammermusik dirigieren könnte. «No problem», sagte Bill. «Das war blauäugig, aber irgendwie schaffte ich es.» Als er dann angefragt wurde, Strawinski zu dirigieren und ebenfalls zusagte, wusste er, dass er sich auf diesem Gebiet weiterbilden wollte. «Ich fühlte mich von Anfang an beim Dirigieren zu Hause.» Es folgten Engagements in Paris, Bosten und New York als Dirigent von Orchestern, Kirchenmusik und Opernensembles.
Via New York nach Liechtenstein
Der Zufall wollte es, dass Bill in New York seine Frau kennenlernte. Eine Liechtensteinerin. Er punktete bei ihr, da er als Einziger einer Abendgesellschaft wusste, wo Liechtenstein liegt und dass es das kleine Land überhaupt gibt. Dass er später in dieses Land auswandern und dort eine Familie gründen würde, hätte er sich damals nicht gedacht. Bereut hat er den Schritt, nach Liechtenstein zu kommen, aber nie. «Zwar war ich am Anfang skeptisch, da ich nicht wusste, welche beruflichen Perspektiven es für mich geben wird. Ich hatte auch Angst, dass ich mich nur langsam integrieren würde.» Es ging aber alles schneller und vor allem glatter als erwartet. Die Stellen als Dirigent und musikalischer Leiter verschiedener Projekte flogen ihm regelrecht zu. «Ich war offensichtlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.» Und das kann er heute noch behaupten. Er vermutet, dass die Musik ihm als Brücke diente – als Sprache, die international verstanden wird. Obwohl er 1998 kaum ein Wort Deutsch sprach, konnte er sich als Chorleiter durchsetzen.
In Liechtenstein ist er zuhause und nach internationalen Engagements sehne er sich eigentlich gar nicht. Er sei auch viel zu beschäftigt, gibt er schmunzelnd an – momentan leitet er mit der Operettenbühne Vaduz und dem Chorseminar Liechtenstein zwei Grossprojekte gleichzeitig. Hier könne er musikalisch noch etwas bewegen, das reize ihn. «In Liechtenstein sind noch Premieren möglich, musikalische Leistungen, die das Land so noch nie sah. Wo sonst ist das möglich?», fragt Maxfield mit einem Leuchten in den Augen. Begeistert spricht er auch von Nachwuchsförderung bei der Operette.
Gerade deshalb möchte er zusammen mit der Internationalen Musikakademie im Fürstentum Liechtenstein, die regionalen Jungmusiker fördert, Nachwuchs zur Operette bringen. Sechs junge Musiker von der Akademie werden im Orchester bei Polenblut mitspielen und ein weiterer hilft bei der Korrepetition. Junge Leute sollen lernen, wie man Operette macht. Dies sei die einzige Möglichkeit, dieses traditionelle Musikgenre in Liechtenstein zu erhalten. Frischer Wind, Mut und Innovation – dafür steht William Maxfield. Nach dem Gespräch kehrt er zurück zur Operettenprobe vor die Bühne und gibt voller Tatendrang den Musikern und Sängern ihren nächsten Einsatz. (jak)
Copyright © 2025 by Vaduzer Medienhaus
Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.